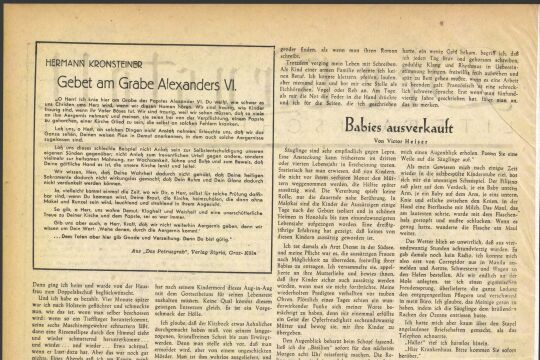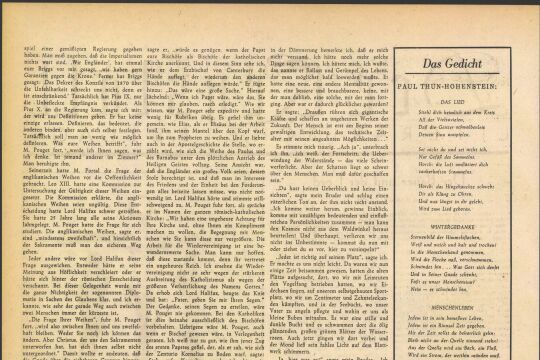Im Jahre 1925, als Sun Yatsen starb, fuhr ich meines Kindes wegen in mein Geburtsland. Ich ging mit meiner Tochter von einem Arzt zum andern, erfuhr aber von allen, daß der Fall hoffnungslos sei. Da hielt ich es für ein Gebot der Klugheit, mich in eine Arbeit zu stürzen, die mir keine Zeit ließ, an mich selbst zu denken. Auch mein Mann hatte ein Jahr Urlaub bekommen, das er an der Cornell-Universität verbringen wollte. Dorthin gingen wir also alle drei. Wir fanden ein kleines, billiges Haus, und auch ich beschloß, zu studieren und eine Abschlußprüfung zu machen.
Es war durchaus kein leeres Jahr. Zuerst lernte ich, was Armut in einer Gesellschaft bedeutet, die so individualistisch ist wie die amerikanische. In China hatte ich mein Brot durch den Unterricht verdient, aber in Amerika fand ich keine Möglichkeit, meinen Lebensunterhalt zu erwerben. Ich mußte es also fertigbringen, den Verdienst des Mannes so zu strecken, daß wir beide studieren konnten, was nur mit der größten Sparsamkeit und durch Entbehrungen möglich war. Ich kaufte jeden Tag zwei Eier, eines für den Mann und eines für das Kind, und einmal in der Woche ein kleines Stück Fleisch. Anstatt Gemüse und Obst im Laden zu kaufen, ließ ich mir von einem Bauern eine Wagenladung Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten und Aepfel bringen. Dieser Vorrat mußte Für den ganzen Winter reichen. Außerdem brauchten wir jeden Tag einen Viertelliter Milch und einen Laib Brot. Die einzige andere Ausgabe war eine kleine Summe, die ich einer Nachbarin geben mußte, damit sie zwei- oder dreimal in der Woche bei dem Kind blieb, wenn ich in die Vorlesung mußte. Glücklicherweise verlangte der Professor, bei dem ich meine Doktorarbeit über den englischen Essay und Roman machte, nicht, daß ich viele Vorlesungen besuchte. Er ließ mich meine Quellen selbst suchen, und dies tat ich bei Nacht. Sobald das Kind im Bett war und sein Vater in seinem Zimmer über seinen Büchern saß, war ich frei. Dann ging ich eine Meile durch den Wald, am Rande einer Schlucht und eines rauschenden Baches entlang, zur Bibliothek. Wie schön war es doch nachts in dieser Bibliothek! Ich war mit meinen Regalen allein, konnte so viele Bücher lesen, wie ich wollte, und nach Belieben denken und schreiben. Erst spät in der Nacht ging ich — mit Widerstreben — fort und marschierte bei Mondlicht oder mit der Laterne heim. Niemand war zu dieser Stunde zu sehen und zu hören; einsam ging ich an der Schlucht entlang, und feuchter Nebel legte sich auf Gesicht und Haar.
Aber selbst mit der größten Sparsamkeit konnte ich nicht durchkommen. Nach Weihnachten sah ich ein, daß etwas geschehen mußte. Ich hatte vor allem keinen warmen Mantel und mußte zudem einige nötige andere Sachen kaufen, wenn ich im Sommer wieder nach China zurückfahren wollte. Da fiel mir eine Geschichte ein, die ich auf der Ueberfahrt geschrieben hatte. Wir hatten die kalte nördliche Route nach Vancouver genommen, weil es die kürzeste war, und wenn mein Kind schlief, setzte ich mich im Speisesaal in eine Ecke und schrieb. Dort hatte ich meine erste Erzählung begonnen, die noch vor der Ankunft in Vancouver fertig war. Mir kam sie zu sentimental und nicht gut vor und ich hatte sie bis jetzt noch nicht verschickt. Jetzt aber, von Angst getrieben, zog ich sie hervor, überarbeitete und kürzte sie und schrieb sie ab. Es war die Geschichte einer chinesischen Familie, deren Sohn eine amerikanische Frau heimbringt, und daher schickte ich sie an das „Asia Magazine“ und wartete. Glücklicherweise brauchte ich nicht lange zu warten — was mir unter solchen Umständen beinahe wie ein Wunder erschien —. denn fast umgehend erhielt ich eine Annahmebestätigung von dem damaligen Redakteur Louis Troelick. Das Honorar betrug hundert Dollar, die für mich so gut wie tausend waren. Das Problem war nur: sollte ich mit einem Teil dieser Summe einen Mantel kaufen oder Collegegelder und Rechnungen zahlen? Ich beschloß, mit dem Mantel noch zu warten und gleich mit einer anderen Geschichte, einer Fortsetzung der ersten, zu beginnen.
Mittlerweile war es bitter kalt geworden. Die Landschaft in Ithaka war mir fremd und wirkte ernüchternd auf mich. Ich fror seelisch und körperlich. Die Berge bieten dort keinen Schutz, sie rollen in langen, parallelen Wellen dahin und werden von tiefen, dunklen Schluchten durchschnitten, in denen sich Flüsse und Seen verbergen. Niederdrückend waren vor allem diese Seen; sie schienen grundlos zu sein. Man erzählte sich gespenstische Geschichten, von jungen Leuten, die in Ruderboten, und Kanus in die Tiefe gezogen worden waren. Indianische Sagen verstärkten diese Wirkung der grauen Wasserflächen. Ich war dort nie glücklich. Ich muß freilich ehrlicherweise zugeben, daß meine Traurigkeit zum nicht geringen Teil mit meiner schwierigen Lage zusammenhing.
Trotzdem gewährte mir Ithaka ein unvergeßliches Erlebnis. Es war das Jahr der totalen Sonnenfinsternis. Teilweise Verfinsterungen des Mondes und der Sonne hatte ich in China mehrfach gesehen. Man konnte sie schon deshalb nicht vergessen, weil die Bevölkerung so große Angst vor ihnen hatte. Sie glaubte, das Licht werde von einem Himmelsdrachen verschluckt. Die Leute liefen auf die Straße und machten mit Gongs und Blechtöpfen einen fürchterlichen Lärm, um den Drachen zu verscheuchen. In Ithaka war die Finsternis von großer Schönheit und sehr eindrucksvoll. Ich beobachtete sie von einem Berggipfel aus. Glücklicherweise war der Tag prächtig und klar. Es war Winter, meilenweit erstreckte sich vor mir das schneebedeckte Land. Kaum je hatte ich einem Ereignis mit so großer Erwartung entgegengesehen. Im Theater bin ich immer in großer Spannung, bevor der Vorhang aufgeht,aber hier spielte sich das Drama auf der Bühne des Weltalls ab, und es herrschte eine erhebende, feierliche Stimmung. Da legte sich ein Schatten über das Land, ein mildes, aber immer finsterer werdendes Zwielicht. Starke Wogen grauer Dunkelheit schienen über das Land zu rollen und die Erde zum Erschaudern zu bringen, bis endlich die Sonne verschwand und die Sterne aus einem schwarzen Himmel leuchteten. Auf meinem Berge war mir zumute wie vielleicht einmal dem letzten Menschen, wenn die Sonne zu Asche verbrennt und die Erde für immer in Dunkelheit zurückläßt ... Wie atmete ich auf, als langsam das helle Tageslicht zurückkehrte! Diese Stunde und ihre Lehre habe ich nie vergessen.
Die zweite Erzählung ging langsam voran. Ich war mit dem Studium, dem Haushalt und der Pflege des Kindes zu stark belastet, und ich zweifelte daran, sie zu Ende führen zu können. Ich suchte also nach einem anderen Wege, mir Geld zu verschaffen. Da fiel mir ein, daß die Universität Geldpreise für wissenschaftliche Arbeiten ausgeschrieben hatte. Kaltblütig erkundigte ich mich nach dem höchsten Preis und erfuhr, daß er für die beste Arbeit über ein internationales Thema verliehen werde. Mein Professor sagte mir jedoch, daß er immer von einem Doktoranden der Geschichtswissenschaft gewonnen würde, und riet mir ab, die Arbeit zu unternehmen.
Ich sagte ihm nicht, daß ich mich auf jeden Fall an sie heranwagen wolle. Der Preis betrug 200 Dollar. Mit der Summe konnte ich das Jahr durchhalten und mir sogar noch einen Mantel kaufen. Zwischen zwei Semestern lagen ein paar Wochen, in denen ich an dem Aufsatz arbeiten konnte. Als Thema wählte ich den Einfluß des Westens auf das Leben und die Kultur der Chinesen. Der Aufsatz schwoll zu einem kleinen Buch an. Alle Manuskripte wurden ohne Namen eingereicht, um ein unparteiisches Urteil zu sichern; die Namen der Verfasser wurden in besonderen Umschlägen im Sekretariat verwahrt. Zwei Wochen vergingen; ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Dann hörte ich, ein Chinese habe den Preis gewonnen, denn nur ein Chinese könnte die preisgekrönte Arbeit geschrieben haben. Eine schwache Hoffnung stieg in mir auf — aber ich unterdrückte sie, denn es gab mehrere glänzend begabte chinesische Studenten an der Universität. Nach einigen Tagen jedoch erhielt ich die amtliche Mitteilung, daß ich den Preis gewonnen hatte. Welch eine Freude war das! Besonders als ich nach der Vorlesung zu meinem Professor ging, der mir abgeraten hatte, und ihm den Brief zeigte...
Ach, es geschieht nicht oft, daß einem inneren Bedürfnis so schnell entsprochen wird, und gerade dann, wenn ein Mensch schon fast Hoffnung und Mut verloren hat! Ich erholte mich rasch von meiner Niedergeschlagenheit, beendete meine Erzählung in guter Stimmung und schickte sie an das „Asia Magazine“, und wieder wurde sie angenommen. Nun kam ich mir auf einmal reich vor; ich kaufte mir einen warmen dunkelgrünen Mantel, der bei mir aushielt, bis ich ihn in der Revolution verlor. Ich gewann den geschwundenen Glauben an mich selbst wiedef irftd' fuRPim Sommer nach China zurück. Ich konnte nfcht nur die materiellen Güter mitnehmen, die ich brauchte, sondern' auch mein zweites Kind, meine erste adoptierte Tochter, ein kleines Lebewesen von drei Monaten, das vom Waisenhause um so lieber abgegeben wurde, als es seit seiner Geburt kaum ein paar Gramm zugenommen hatte. Angeblichwollte nichts bei ihr anschlagen. „Dann geben Sie es mir“, sagte ich. Und sobald sich die Kleine in mütterlicher Obhut fühlte, begann sie zu essen und wurde dick und gesund. Wie leicht kann man einen Menschen glücklich machen — und was für wunderbare Auswirkungen hat ein solches Glücksgefühl!
Noch etwas anderes tat ich in jenem Jahr in Ithaka. Ich entdeckte, daß die asiatischen Studenten in Cornell meistens einsam und ohne jeden Anschluß waren. Nur wenige, höchstens die, welche hervorstechende körperliche oder geistige Vorzüge hatten, fanden amerikanische Freunde. Viele von ihnen, zumeist Chinesen, lebten ganz für sich und versenkten sich in ihre Bücher, denn sie waren zu arm, um etwas für Vergnügungen ausgeben zu können. Es war ein großer Nachteil, daß sie das amerikanische Leben gar nicht kennenlernten. Auch den Amerikanern entging auf diese Weise eine vorzügliche Gelegenheit, etwas über die Chinesen zu erfahren, denn schon damals begriff ich, daß der Osten und der Westen in einen schrecklichen Konflikt geraten würden, wenn sie sich nicht gegenseitig verständen. Ich versuchte daher, die Frauen Ithakas durch ihre Klubs und Organisationen zu veranlassen, ihre Häuser chinesischen Studenten zu öffnen, damit diese jungen Leute, die von so weit gekommen waren, wenigstens etwas vom gesellschaftlichen Leben einer amerikanischen Stadt, erfuhren. Ich hatte jedoch nicht viel Erfolg mit meinen Bemühungen. Die Frauen hörten mich zwar freundlich an, aber sie waren viel zu sehr mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Einige sträubten sich sogar mit Nachdruck, ihre Söhne und Töchter mit Chinesen verkehren zu lassen. Sie konnten nicht voraussehen, daß eine Begegnung auf jeden Fall stattfinden würde — wenn nicht im Frieden, dann durch einen Krieg.
Als es Sommer wurde, kehrten wir nach China zurück, das für mich immer noch die Heimat war.
Aus dem Buch „Mein Leben, meine Welten“, Verlag Kurt Desck, Wien