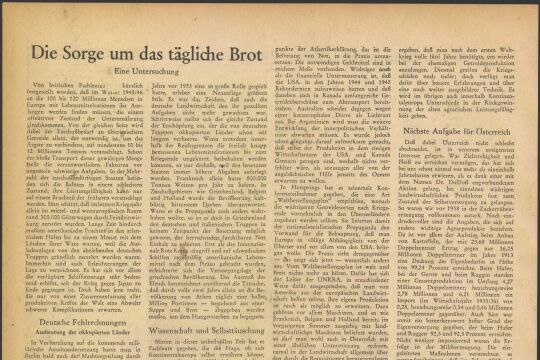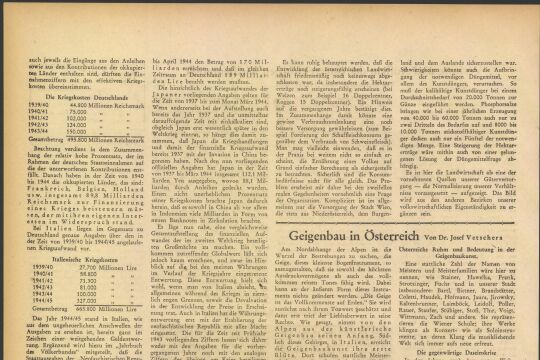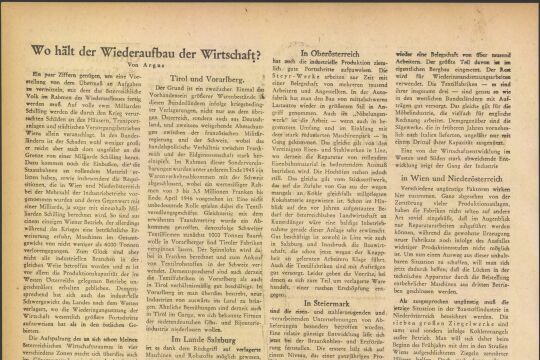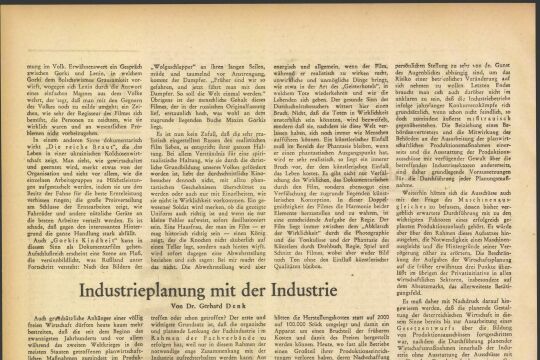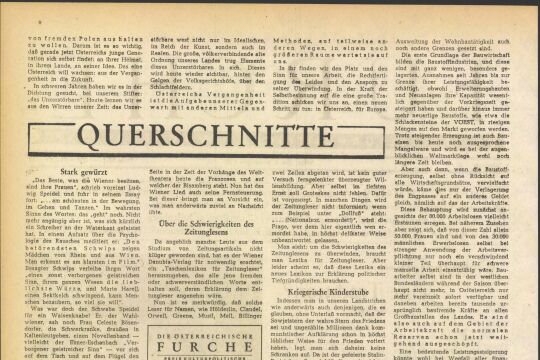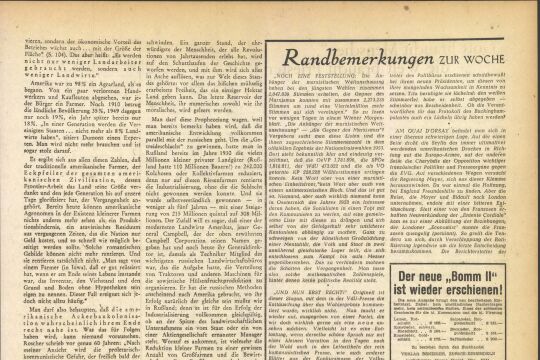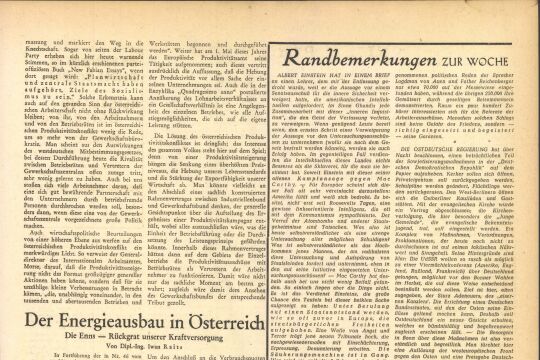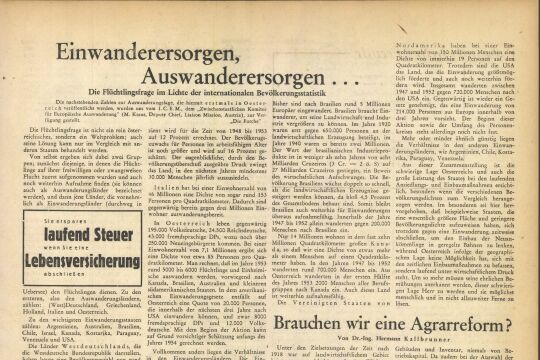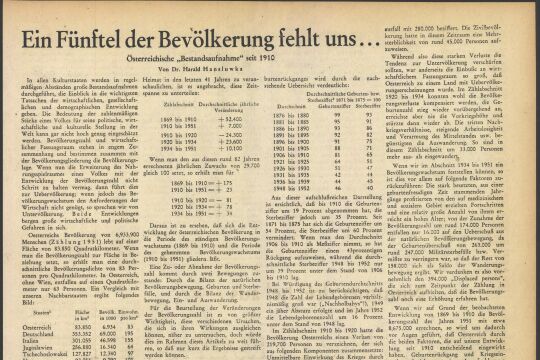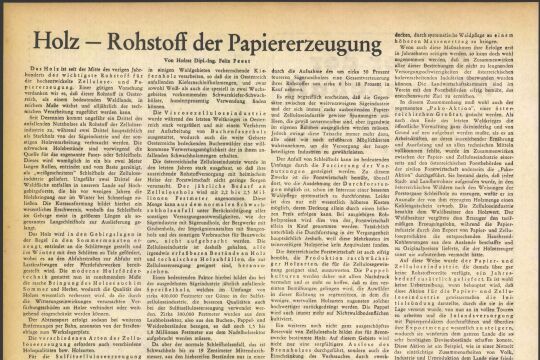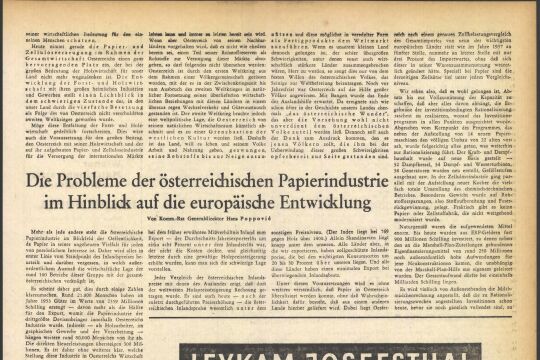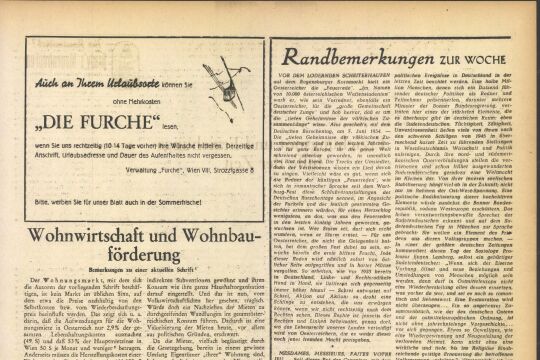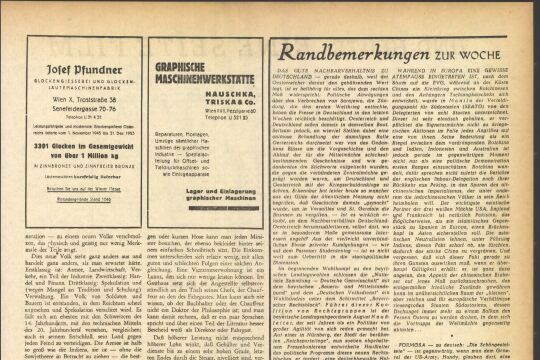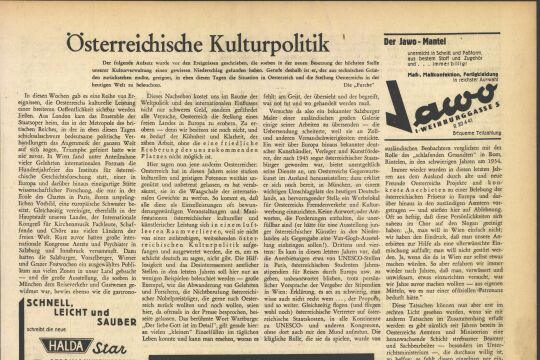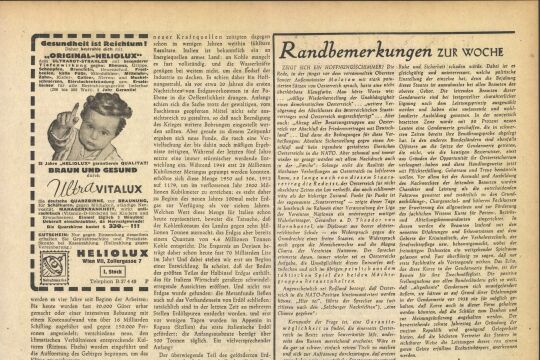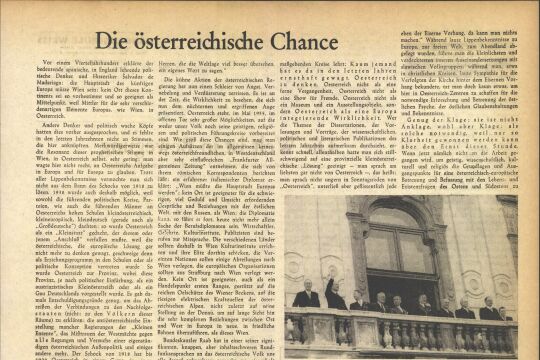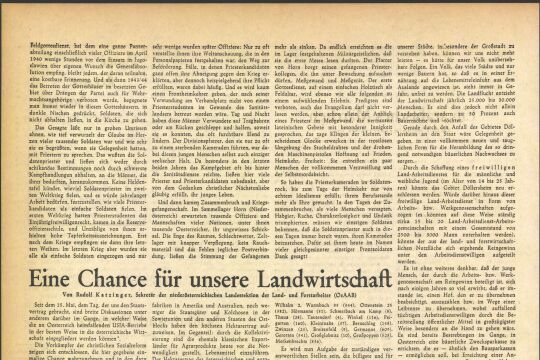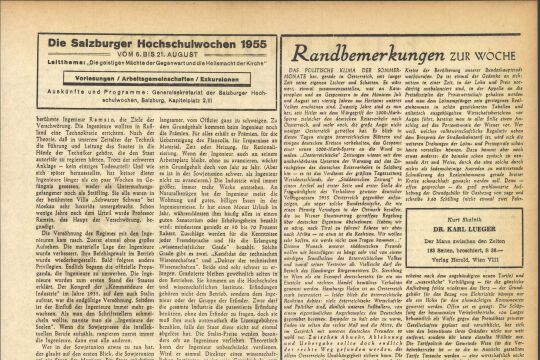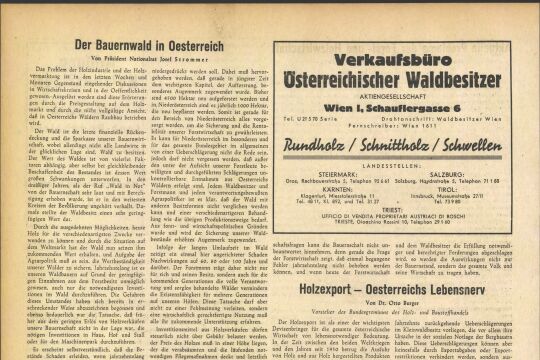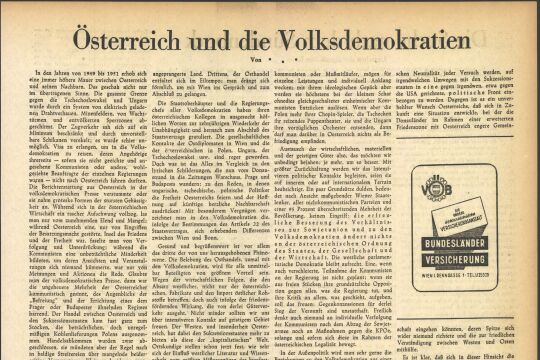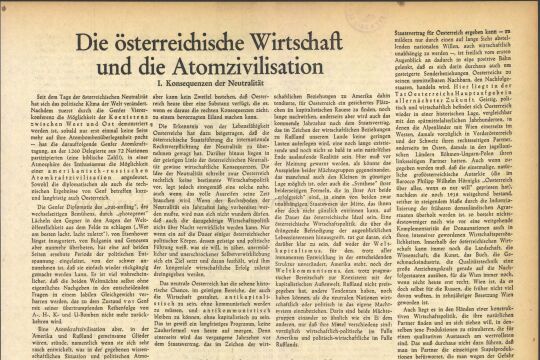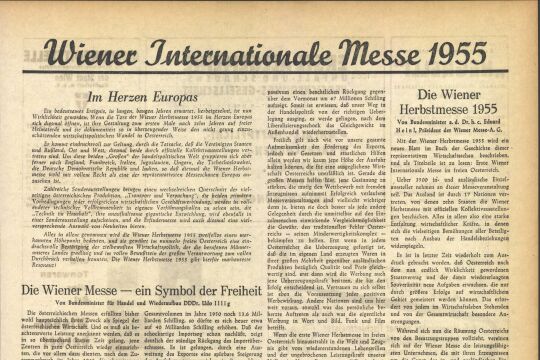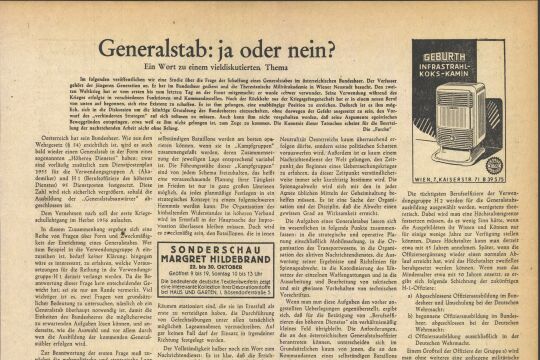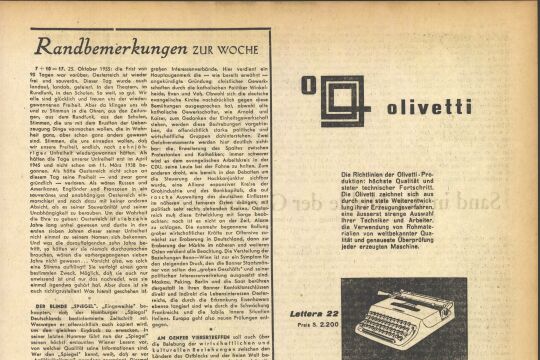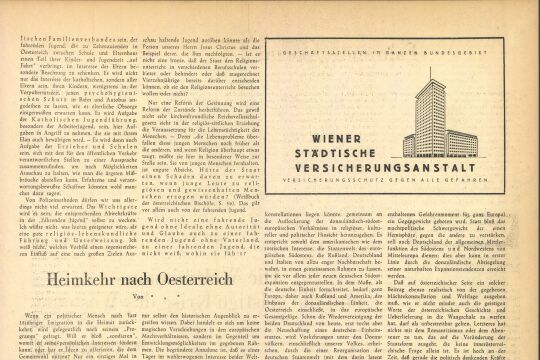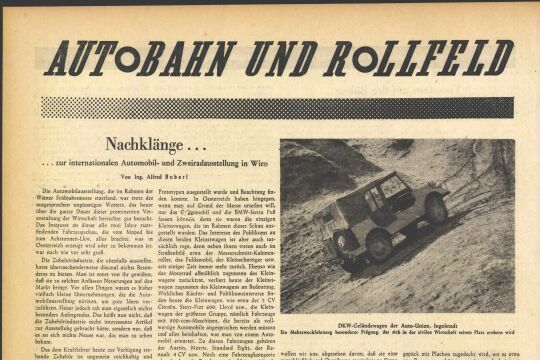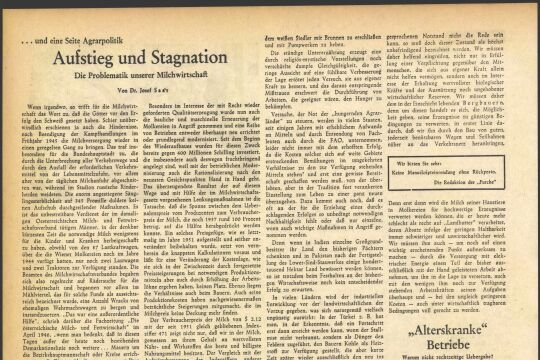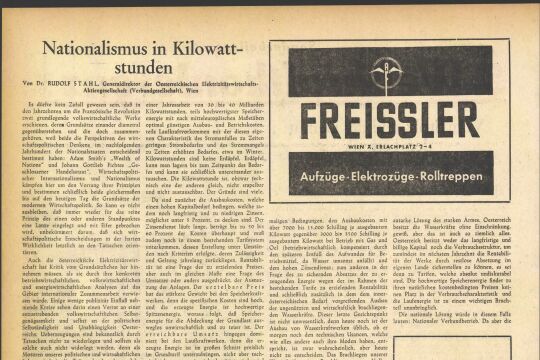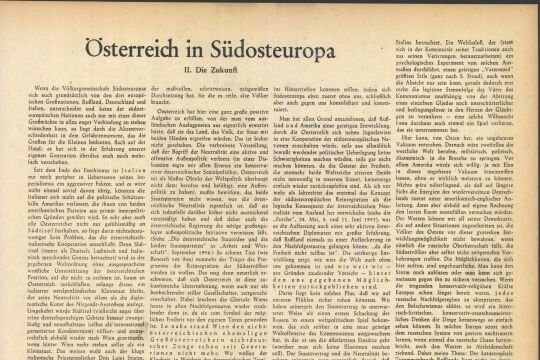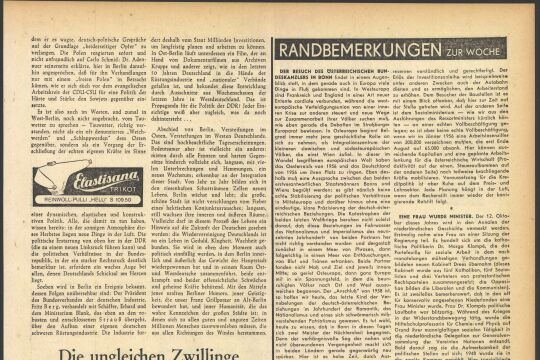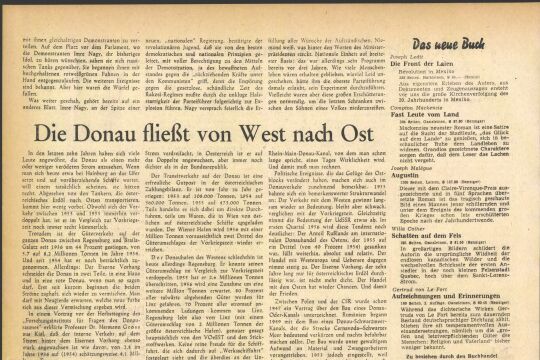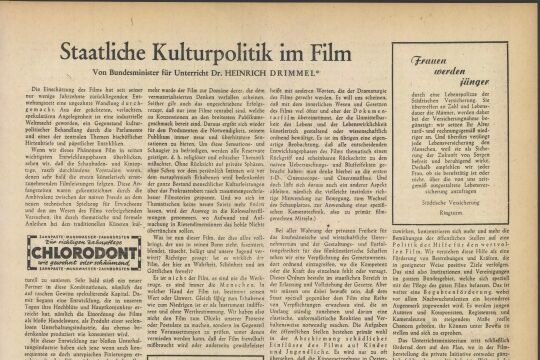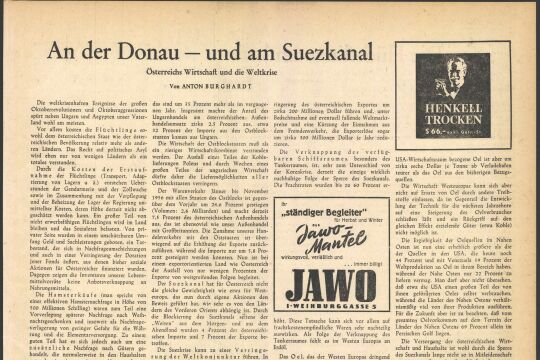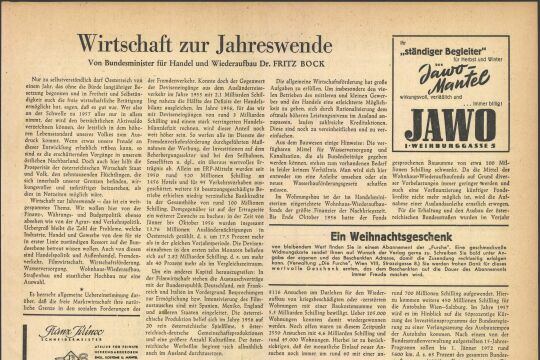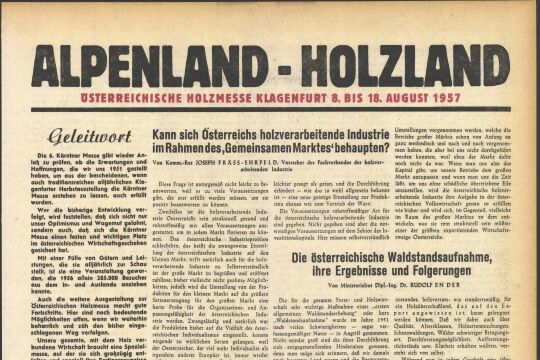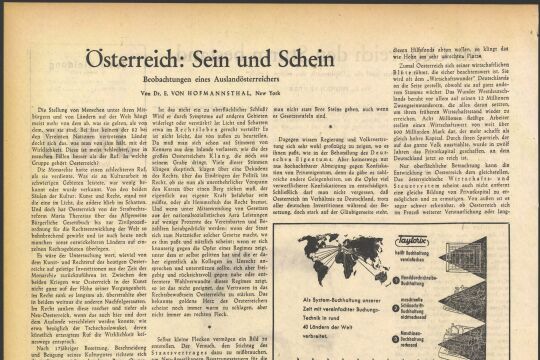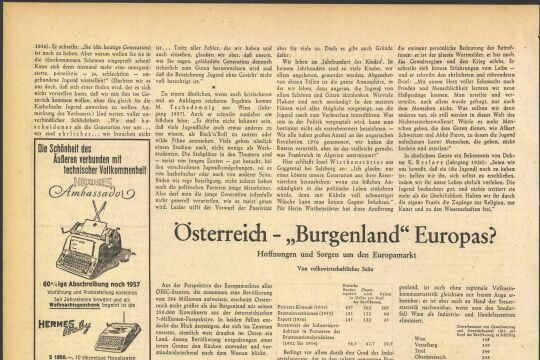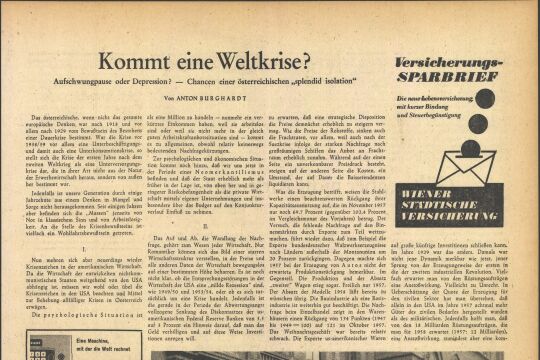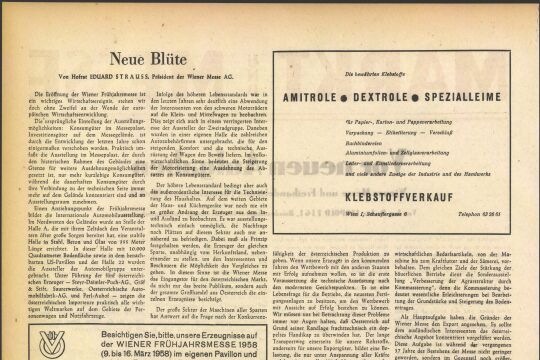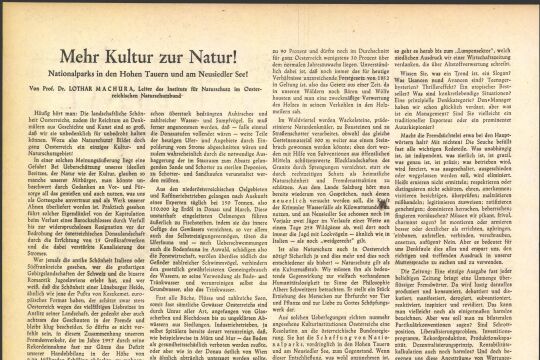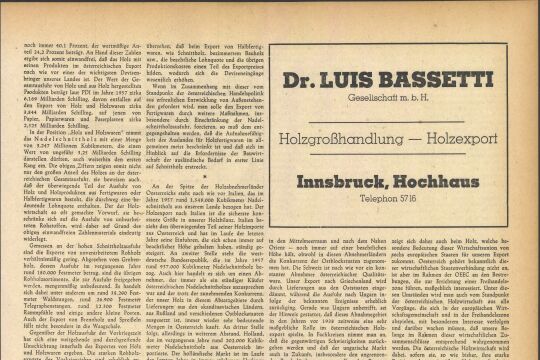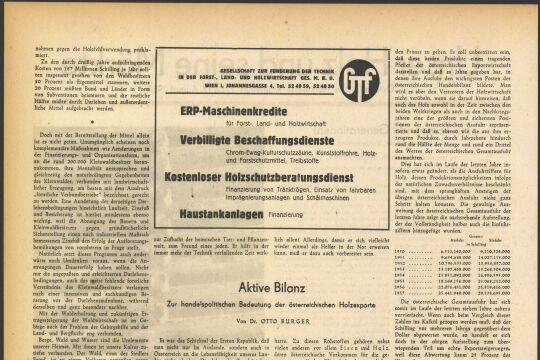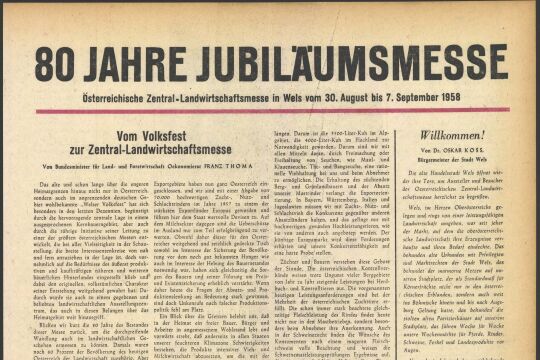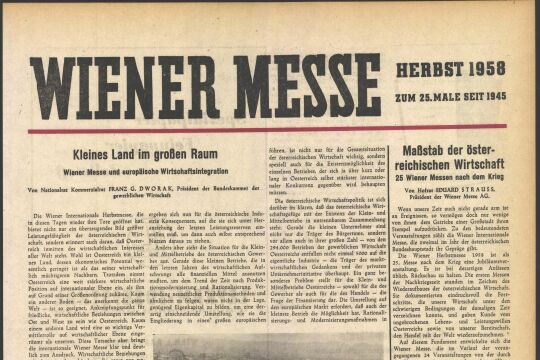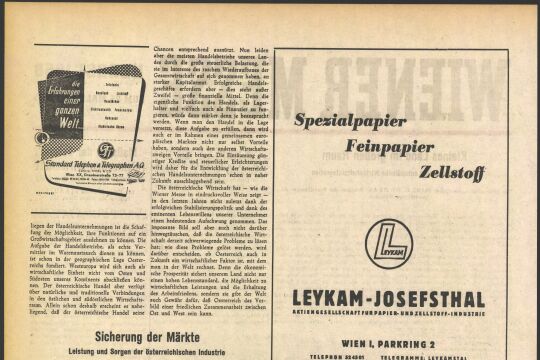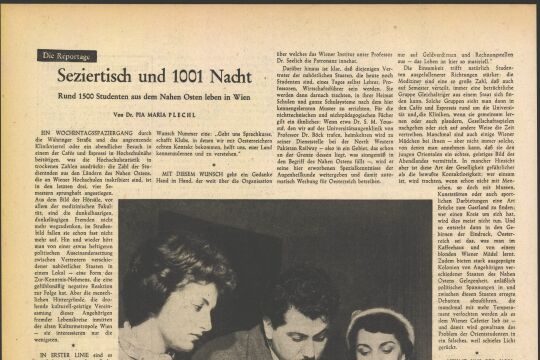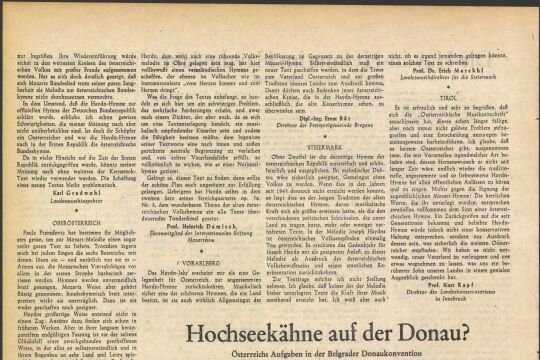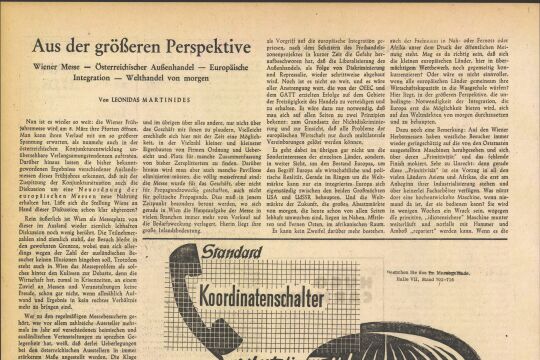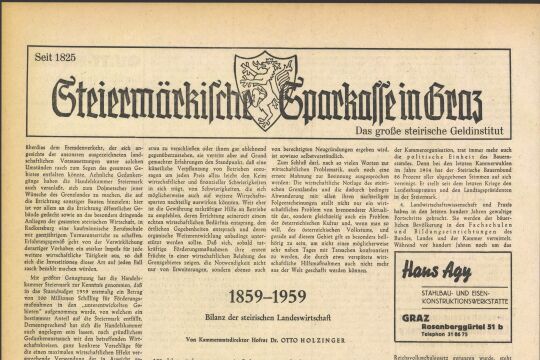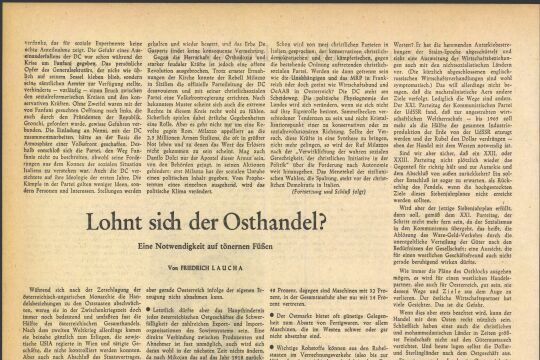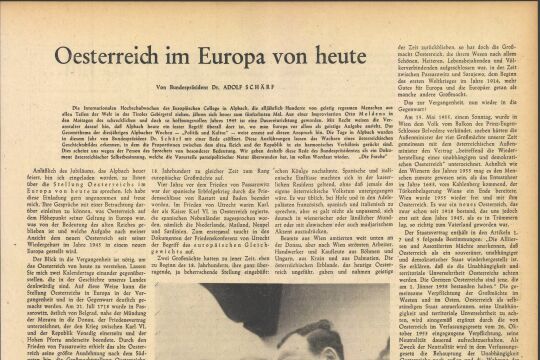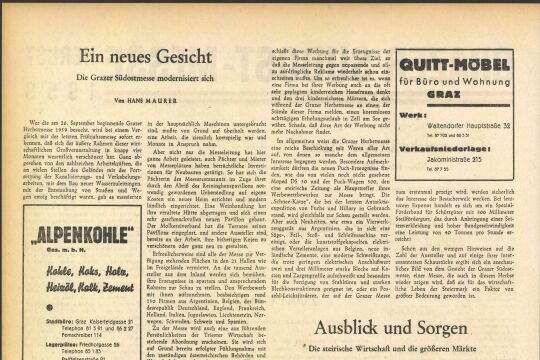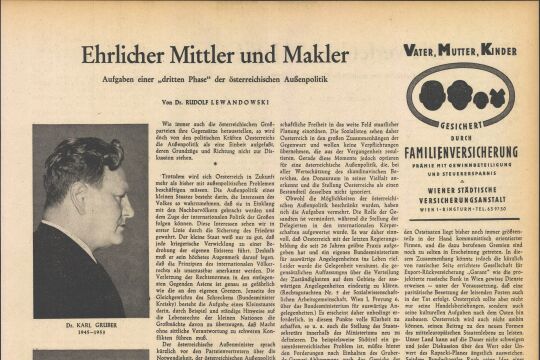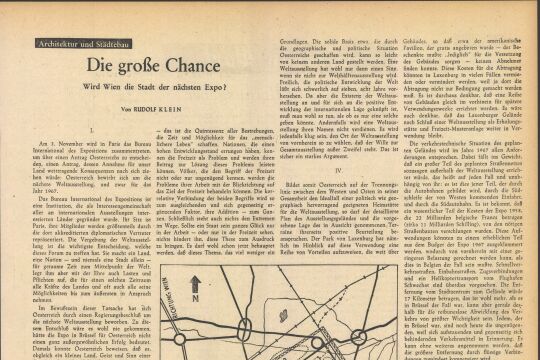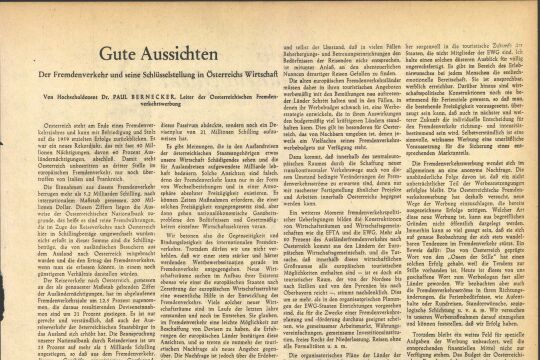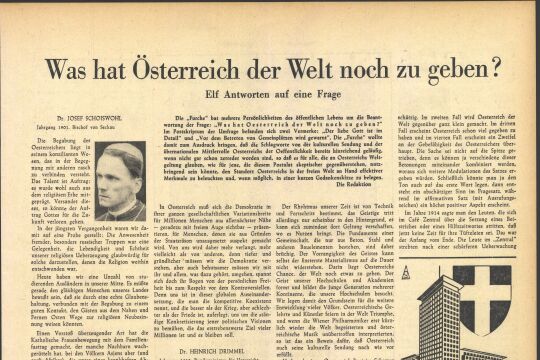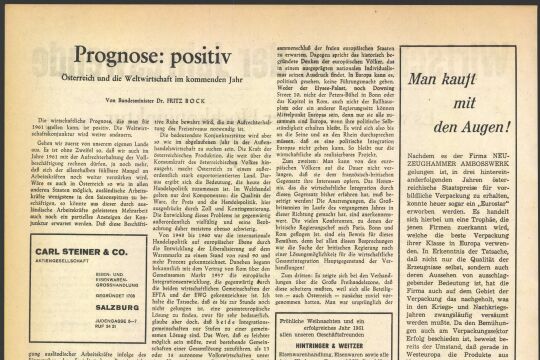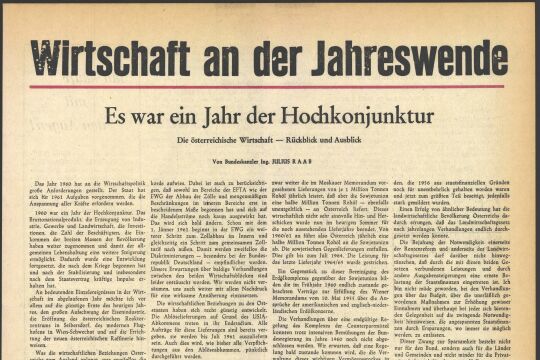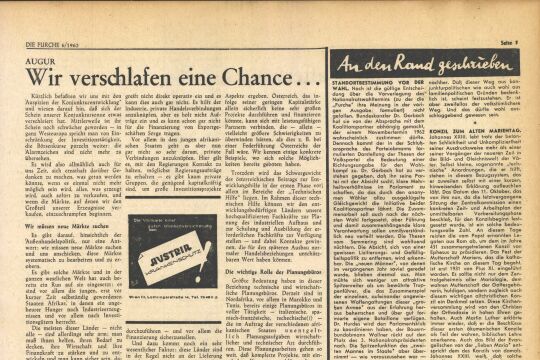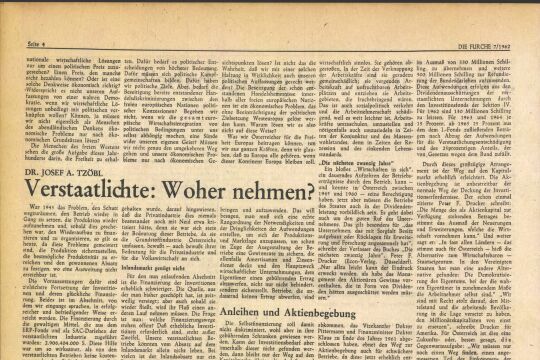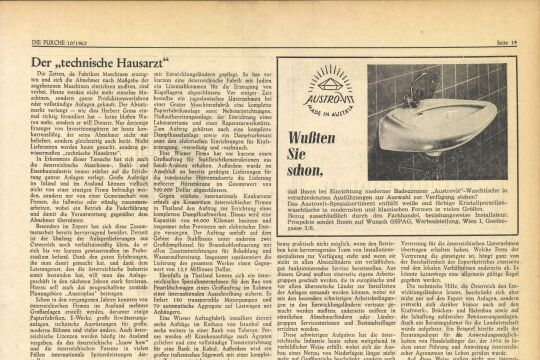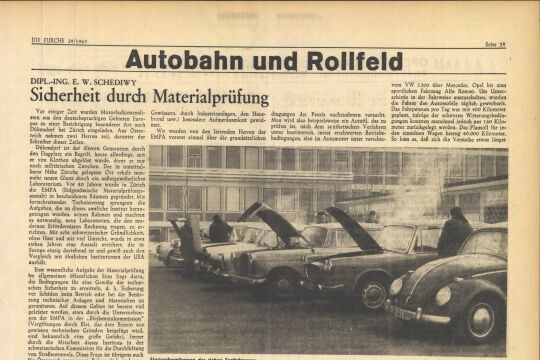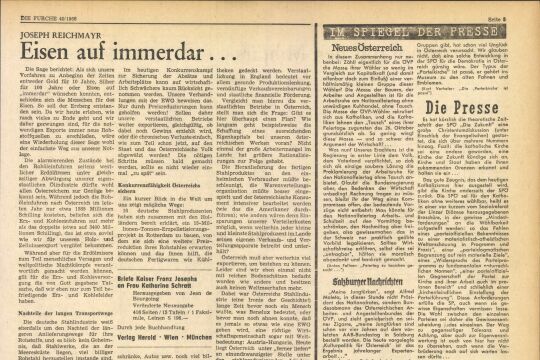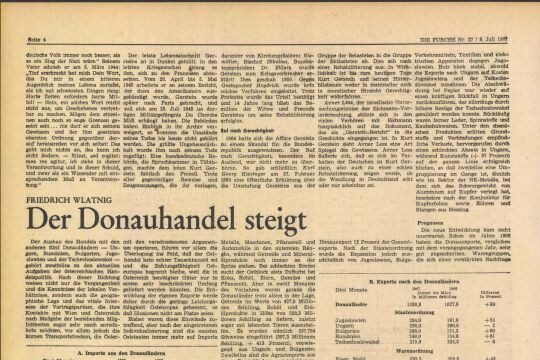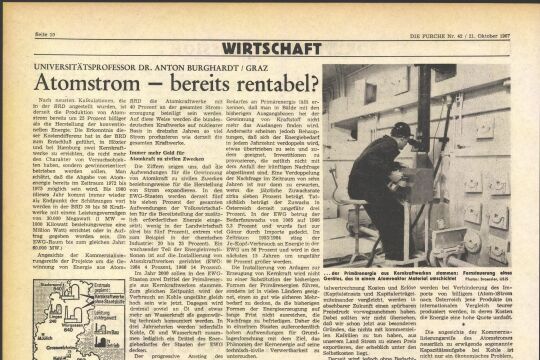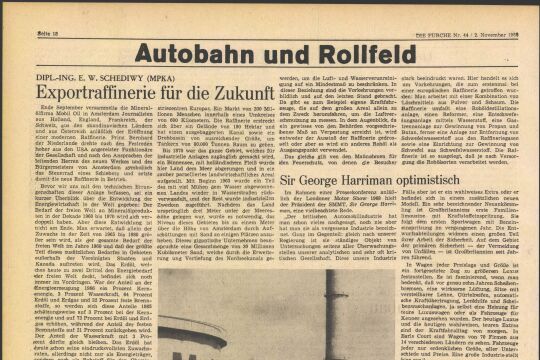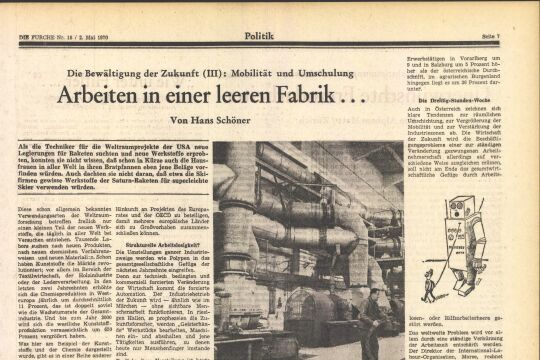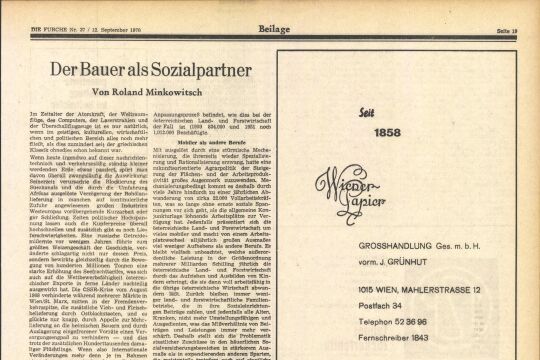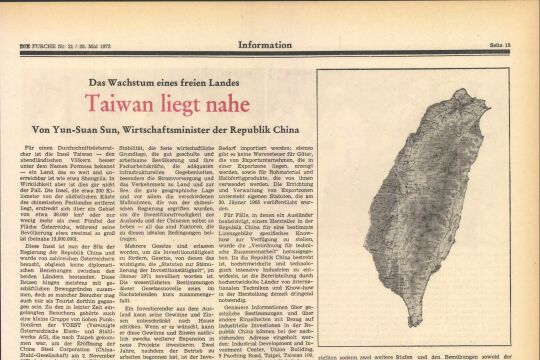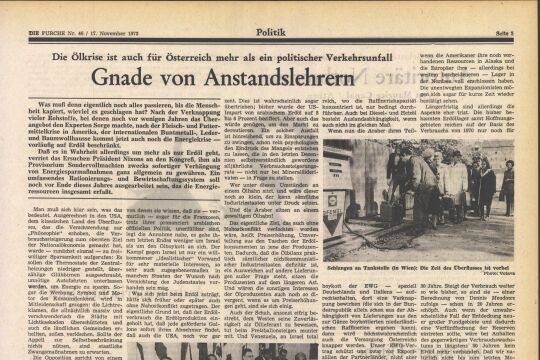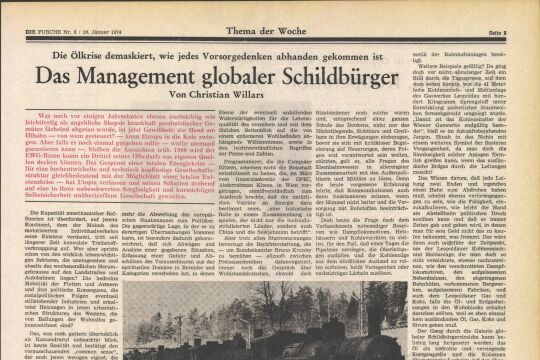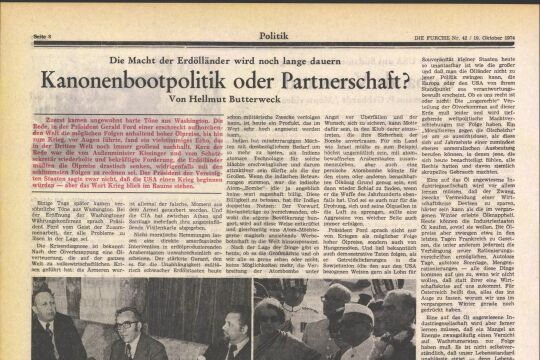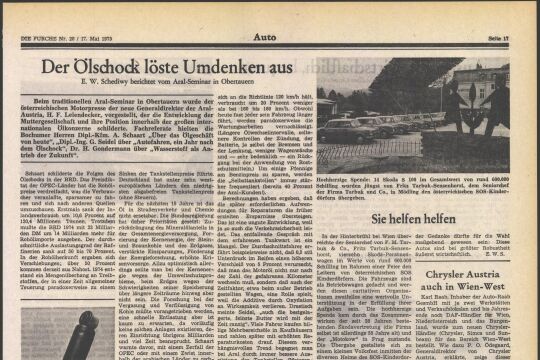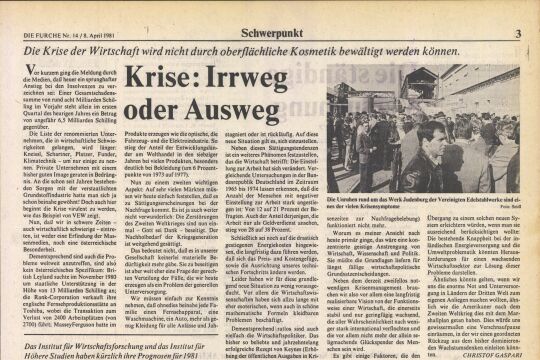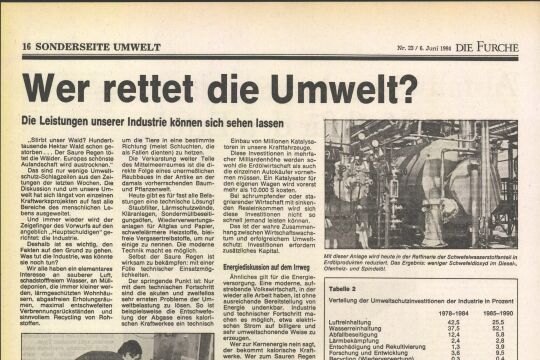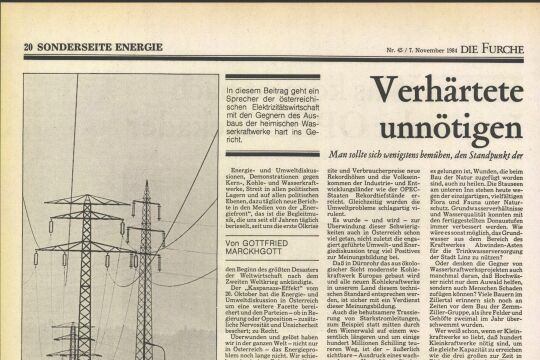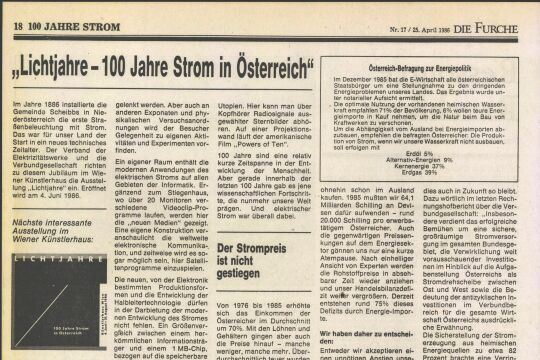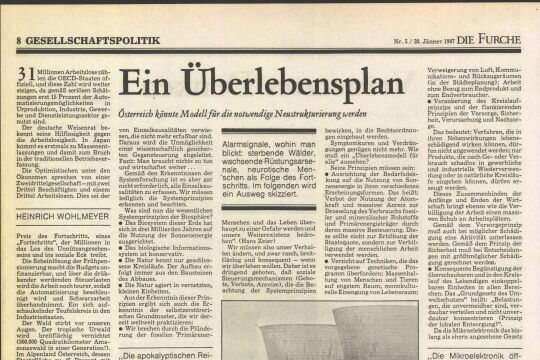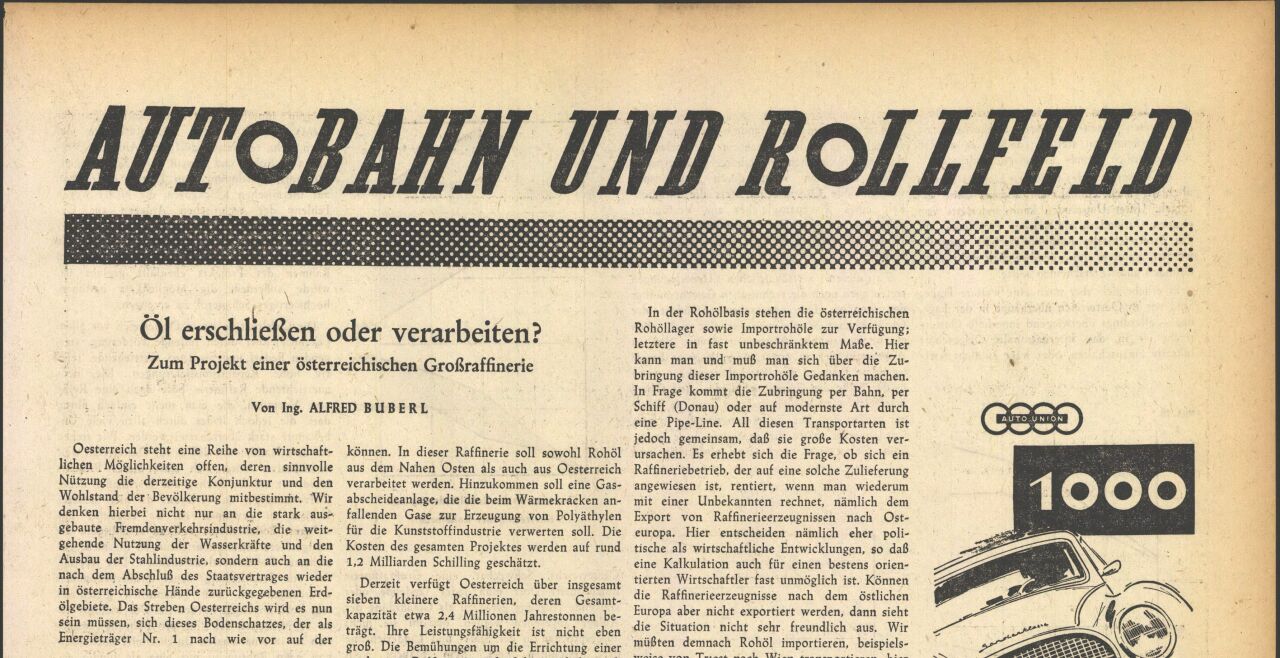
Oesterreich steht eine Reihe von wirtschaftlichen .Möglichkeiten offen, deren sinnvolle Nützung die derzeitige Konjunktur und den Wohlstand der Bevölkerung mitbestimmt. Wir denken hierbei nicht nur an die stark ausgebaute Fremdenyerkehrsindustrie, die weitgehende Nutzung der Wasserkräfte und den Ausbau der Stahlindustrie, sondern auch an die nach dem Abschluß des Staatsvertrages wieder in österreichische Hände zurückgegebenen Erdölgebiete. Das Streben Oesterreichs wird es nun sein müssen, sich dieses Bodenschatzes, der als Energieträger Nr. 1 nach wie vor auf der
ganzen Welt hoch im Kurs steht, so zweckmäßig wie möglich zu bedienen. (Erdöl und Erdgas decken heute 50 Prozent des gesamtes Energieweltbedarfes, in Oesterreich neben der weitreichenden Gewinnung von Energie aus Wasserkraftwerken immerhin 20 Prozent des gesamten Energiekonsums.) Diese wirtschaftliche Forderung wird vor allem durch verschiedene Rücksichten, die man auf die spezielle Art der Gewinnung von Erdöl nehmen muß, beeinflußt, die etwa bei der Erzförderung wegfallen. Seit 1938 wurde an unseren Oelquellen Raubbau betrieben, und Oesterreich hat seit 1955 die undankbare Aufgabe übernommen, diesen Bodenschatz nun wieder durch pfleglichen Abbau, was leider gleichbedeutend mit Drosselung der Förderung ist, zu sichern. Auf lange Sicht hinaus gesehen wird es dadurch möglich sein, das Maximum an Rohölgewinnung zu erreichen. Es wurden deshalb im Jahre 1957 nur noch 3,185.598 Tonnen gefördert, während es im Jahre 1955 noch 3,666.112 Tonnen waren. Der Rückgang beläuft sich demnach etwa auf ein Siebentel der seinerzeitigen Förderung. Die Erdölreserven werden derzeit auf etwa 52 Millionen Tonnen geschätzt. Werden sie zu rasch abgebaut, dann kann unter Umständen ein größerer Teil dieses Bestandes verlorengehen.
Oesterreich will jedoch Rohöl nicht nur fördern, sondern es auch in einer eigenen österreichischen Großraffinerie, die im Raum von Schwechat entstehen soll, verarbeiten. Die staatliche Oesterreiehische Mineralölverwaltungs-Aktiengesellschaft plant die Errichtung eines Raffineriebetriebes, der Ende 1959 mit einer Kapazität von 1,9 Millionen Tonnen jährlich angefahren werden soll. Man beabsichtigt, bis 1962 auf 2,5 Millionen Jahrestonnen erhöhen zu
können. In dieser Raffinerie soll sowohl Rohöl aus dem Nahen Osten als auch aus Oesterreich verarbeitet werden. Hinzukommen soll eine Gasabscheideanlage, die die beim Wärmekracken anfallenden Gase zur Erzeugung von Polyäthylen für die Kunststoffindustrie verwerten soll. Die Kosten des gesamten Projektes werden auf rund 1,2 Milliarden Schilling geschätzt.
Derzeit verfügt Oesterreich über insgesamt sieben kleinere Raffinerien, deren Gesamtkapazität etwa 2,4 Millionen Jahrestonnen beträgt. Ihre Leistungsfähigkeit ist nicht eben groß. Die Bemühungen uin die Errichtung einer modernen Raffinerie sind daher naheliegend. Wenn man jedoch dieses Projekt genauer untersucht, dann steigen dem unbefangenen Betrachter Zweifel an seiner Rentabilität auf lange Sicht auf.
Die erste Frage, die man sich stellt, ist die nach der effektiven Rohölbasis, die in Oesterreich noch zur Verfügung steht. Bei den bereits erwähnten 52 Millionen Tonnen handelt es sich um eine Schätzung, die stimmen kann, aber nicht unbedingt stimmen muß; ganz abgesehen davon, daß die gesamte lagernde Menge Rohöls nicht unbedingt förderfähig sein muß. Dazu kommt noch, daß Oesterreich verpflichtet ist, bis zum Jahre 1965 jährlich eine Million Tonnen Rohöl an die Sowjetunion zu liefern. Welch ungeheure Belastung diese Reparationslieferungen für die österreichische Erdölwirtschaft darstellen, geht am besten daraus hervor, daß sie etwa ein Drittel der Förderung des vergangenen lahres ausmachen. Es ist natürlich durchaus;*Aöglich,“da8 hier auf dem Verharfd •
lungswege eine Entschärfung eintritt. Möglicherweise ist die Sowjetunion dazu bereit, ihre Forderungen herunterzuschrauben, möglicherweise könnte hier auch durch eine finanzielle Ablöse oder Lieferung eines durch Oesterreich bezahlten Oeles aus einem der Sowjetunion näherliegenden, rohölfördernden Ländern Erleichterung geschaffen werden. Aber auch wenn diese Verhandlungen günstig verlaufen sollten, stellten sie bestenfalls eine für Oesterreich sicherlich wichtige Erleichterung dar, die aber das Gesamtbild nicht wesentlich verändert.
Für die Gründung einer solchen Großraffinerie, über deren Zweckmäßigkeit die Sachverständigen vielfach geteilter Meinung sind, erscheinen aber zwei Voraussetzungen in erster Linie wichtig: die bereits erwähnte Rohölbasis und ein entsprechend aufnahmefähiger Markt für die Raffinerieerzeugnisse.
In der Rohölbasis stehen die österreichischen Rohöllager sowie Importrohöle zur Verfügung; letztere in fast unbeschränktem Maße. Hier kann man und muß man sich über die Zubringung dieser Importrohöle Gedanken machen. In Frage kommt die Zubringung per Bahn, per Schiff (Donau) oder auf modernste Art durch eine Pipe-Line. All diesen Transportarten ist jedoch gemeinsam, daß sie große Kosten verursachen. Es erhebt sich die Frage, ob sich ein Raffineriebetrieb, der auf eine solche Zulieferung angewiesen ist, rentiert, wenn man wiederum mit einer Unbekannten rechnet, nämlich dem Export von Raffinerieerzeugnissen nach Osteuropa. Hier entscheiden nämlich eher politische als wirtschaftliche Entwicklungen, so daß eine Kalkulation auch für einen bestens orientierten Wirtschaftler fast unmöglich ist. Können die Raffinerieerzeugnisse nach dem östlichen Europa aber nicht exportiert werden, dann sieht die Situation nicht sehr freundlich aus. Wir müßten demnach Rohöl importieren, beispielsweise von Tnest nach Wien transportieren, hier verarbeiten und die Fertigprodukte wiederum nach den südlichen und westlichen Bundesländern befördern, wodurch sie nunmehr mit einer doppelten Frachtrate belastet sind. Für die südlichen und westlichen Bundesländer wird es sich unter Umständen als billiger und einfacher herausstellen, Fertigprodukte aus benachbarten ausländischen Raffinerien zu importieren, die bekanntlich eine beträchtliche Ueberschuß-kapazität aufweisen. Am Rande steht schließlich die Frage auf, wie sich Importe von Raffinerieprodukten nach der Schaffung der europäischen Freihandelszone für den österreichischen Verbraucher darstellen werden. Die Kapazität der Großraffinerie ist aber auf einen Absatz in allen Bundesländern angewiesen, da sie für Wien und seine weitere Umgebung, wo die Frachtspesen sich in einem günstigen Rahmen bewegen würden, zu groß ist. Mit Importen von Rohöl muß aber auf jeden Fall gerechnet werden, da nach Ansicht der Fachleute zur Aufrechterhaltung der 2,5!-Millionen-lalu:estorineniKap'ai“ität“ über“ kurz1 oder lang die Heimische Autbnrigung zu gering sein wird.
Die österreichische Großraffinerie wird daher, was das Rohmaterial betrifft, mit einem Mischpreis rechnen müssen, der sich aus verhältnismäßig preisgünstigem heimischem Oel und stark frachtbelastetem Importöl zusammensetzen wird. Sie muß aber auch damit rechnen, daß der Anteil der teuren Importware ständig zunehmen wird, und dies selbst nach 1965 (Wegfall der Reparationen an die Sowjetunion), denn man nimmt für 1970 bereits einen Verbrauch von 3 Millionen Tonnen Erdölprodukten (gegenüber 2 Millionen Tonnen im Jahre 1957) an.
Dazu kommen noch die Schwierigkeiten in 1 der Planung und Ausstattung einer Raffinerie, da gerade hier immer wieder neugewonnene Erkenntnisse fortlaufende technische Aenderungen erzwingen. Es ist schon vorgekommen, daß fixe, fertige Raffinerienplanungen durch neueste Er-
kenntnisse plötzlich überholt wurden und eine völlige Neuplanung notwendig machten. Dies widerfuhr internationalen Oelfirmen, die über große Erfahrung und weltweiten Ueberblick verfügten.
Aber nicht nur in der Errichtung von Raffinerien hat Oesterreich nur wenig Erfahrung, sondern auch in der Herstellung von Schmiermitteln, Kraft- und Brennstoffen nach allerletzten Erkenntnissen. Wie schwierig es ist, hier an die Qualität der international gängigen Raffinerieprodukte heranzukommen, geht allein daraus hervor, daß es heute nicht weniger ,als rund 5000 verschiedene Zusätze gibt, von denen für jedes Fertigprodukt nur jeweils einige brauchbar sind. Sie richtig zu wählen, erfordert nicht nur enorme Erfahrung, sondern auch entsprechende Mittel, vor allem aber ausgezeichnete Fachkräfte, auf die wir in Oesterreich leider nicht greifen können. Heute setzt zum Beispiel die internationale Oelindustrie bereits Atomwissenschaftler ein, die auf kürzestem Wege zu ansonsten jahrelange Erprobung erfordernden Erkenntnissen gelangen. Oesterreich wird sich also relativ eng an eine der internationalen Firmen anschließen müssen, um diesen Mangel auszugleichen. Dieser Umstand aber schließt die Gefahr in sich, daß diese Hilfe keineswegs uneigennützig geleistet wird, sondern der betreffenden Firma vielmehr die Möglichkeit schafft, starke eigene Interessen zu verfolgen, wie etwa die Lieferung der erforderlichen Ausrüstungsgegenstände, den Absatz überschüssigen Rohöls usw. Man wird sich von
dieser Seite also kaum damit zufriedengeben, Oesterreich einen gewissen Erfahrungsschatz zur Verfügung zu stellen, sondern es werden wahrscheinlich fremde Interessen eindringen.
Die Versorgung des östlichen Europas könnte allenfalls auch einmal von anderer Seite erfolgen. Unter Umständen kann anderseits von einigen Ostländern ein starker Preisdruck auf das österreichische Raffineriegeschäft ausgeübt werden, wenn es aus irgendwelchen politischen Gründen günstig erscheinen sollte.
Es erhebt sich aber noch eine weitere Frage: Sind wir in Oesterreich überhaupt in der Lage, uns — allerdings überwiegend innerhalb Oesterreichs — in das. internationale Oelgeschäft lukrativ einzuschalten, oder wäre es nicht wirt-
schaftlich günstiger, bei der Errichtung einer Großraffinerie entsprechende Verträge mit internationalen Oelfirmen einzugehen, die ein relativ geringes Risiko für uns enthielten? Feststeht jedenfalls, daß das Projekt in seiner jetzigen Form ein gewisses Ausmaß an Spekulation beinhaltet — an sich eine Erscheinung, die im Oelgeschäft nicht eben ungewöhnlich ist. Es erscheint uns wichtig, zu überlegen, daß es sich bei der OeMV AG. um eine, international gesehen, kleine Gesellschaft handelt, die nur ge-
ringe Möglichkeiten hat, eventuell auftretende größere Verluste durch andere Gewinne wettzumachen; es sei denn durch eine Mehrbelastung des österreichischen Staatsbürgers. Internationalen Oelfirmen steht durch eine weltumspannende Organisation stets die Möglichkeit eines Riskenausgleicb.es zur Verfügung; außerdem ist bei der Kapitalbildung dieser Firmen auf größere Ausfälle schon Bedacht genommen.
Zu diesen wirtschaftlichen Ueberlegungen treten auch noch die technischen Gesichtspunkte der Planung. Der vorgesehene Standort der Großraffinerie beispielsweise scheint nicht eben glücklich gewählt. Abgesehen davon, daß in Anbetracht der zu erwartenden Importe besser irgendein Platz an der Westbahnstrecke — etwa in der Nähe der Grenzlinie Nieder- und Oberösterreich — zu wählen gewesen wäre, da damit ein großer Teil der Zulieferungsstrecke erspart worden wäre, hätte die zentralere Lage innerhalb Oesterreichs auch eine einfachere und
kostensparendere Belieferung des gesamten Bundesgebietes mit Raffinerieprodukteri ermöglicht.
Ist es außerdem angezeigt, gerade in die unmittelbare Umgebung des größten Flughafens
Oesterreichs, Schwechat, eine Großraffinerie hinzubauen? Dort muß jedes landende oder startende Flugzeug geradezu als Gefährdung der Anlage angesehen werden, obwohl sie nicht ausgesprochen in der Start- und Landerichtung der Maschinen liegt. Man braucht kein Schwarzseher zu sein, um sich vorzustellen, was geschieht, wenn in diese ausschließlich höchst brennbare-und explosive Stoffe erzeugende und lagernde Anlage ein Flugzeug stürzt. Als die jetzige Schwechater Raffinerie angelegt wurde, befand sich der Hauptflugplatz in Aspern. Da man für die Zukunft nur mit einem Ansteigen des Flugverkehrs rechnen kann, wird die Situation für die Großraffinerie demnach eine ständige Verschärfung erfahren.
Eine eigene österreichische Raffinerie würde sicherlich eine Reihe von Vorteilen bringen, wenn alle Unbekannten sich letzten Endes so positiv erweisen, wie man dies heute von vielen Seiten erhofft. Es sind dies: Verringerung der Transportkosten des Rohöls und der Produkte zwischen den einzelnen Raffinerien sowie Brennstoffersparnis auf Grund übermäßigen Wärmeverbrauchs in den Destillations- und Krack-
anlagen innerhalb der fünf Raffinerien der OeMV, Ersparnis der Reparaturkosten der alten, sehr reparaturbedürftigen Anlagen, Verlust von Rohöl und Benzin beim Kesselwagentransport, Gewinnung von Propan und Butan aus thermischen Krackgasen, die bisher wegen Fehlens der technischen Anlagen zur Gewinnung von Optan,'Propan und Butan, die verkäuflich wären, nicht möglich ist. Durch die Schaffung einer Selektivraffination, die im Rahmen des Projekts ebenfalls geplant ist, würde außerdem die Möglichkeit bestehen, hochwertiges Schmieröl zu erzeugen.
Die Oelsituation ist in Oesterreich vor allem gekennzeichnet durch fallende Förderung, steigenden Bedarf und bis 1965 feststehende, relativ hohe Reparationslieferungen. Die neuzuerrichtende Raffinerie böte dazu eine Reihe von Vorteilen, die man nicht einfach abtun darf, die jedoch leider durch allzu viele Unbekannte stark überschattet werden. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß es für Oesterreich weit vorteilhafter wäre, sich statt dieses Projekts intensiver auf das Suchen und Erschließen neuer Oelvorkommen zu verlegen, da hier sicheres Kapital zu gewinnen ist. Es erscheint uns sicherer, Bodenschätze voll zu erschließen, als riesige Verarbeitungseinrichtungen für nicht gesichertes Rohmaterial aufzubauen. Das Kapital, das zur Erschließung neuer Erdölvorkommen erforderlich ist, muß bekanntlich gleichfalls sehr hoch angesetzt werden (im Durchschnitt bis zu 13 Millionen Schilling pro Bohrung), wobei sich im internationalen Durchschnitt noch dazu von neun Bohrungen nur eine als fündig erweist, was auch für Oesterreich zutrifft. In Anbetracht dessen und des auf der ganzen Welt steigenden Energiebedarfs, der weder auf Kohle noch innerhalb der nächsten Jahre auf Atomkraft umgelegt werden kann, wird die Rohöl-und Erdgasförderung jährlich um etwa 8,5 Prozent ansteigen müssen. Hier sind die großen Chancen für die österreichische Erdölgewinnung zu suchen. Sicher ist aber, daß wit in Oesterreich nicht die Mittel haben, Bohrungen und die Erbauung einer Croßraffinerie parallel laufen zu lassen, sondertl daß das eine wahrscheinlich nur auf Kosten des anderen forciert werden kann. Solange aber für die Errichtung einer großen, modernen Raffinerie keine genügenden Sicherheiten gegeben sind und die meisten diesbezüglichen Fragen weitgehend ungeklärt sind, erscheint das Projekt eher optisch als real wirtschaftlich vorteilhaft.