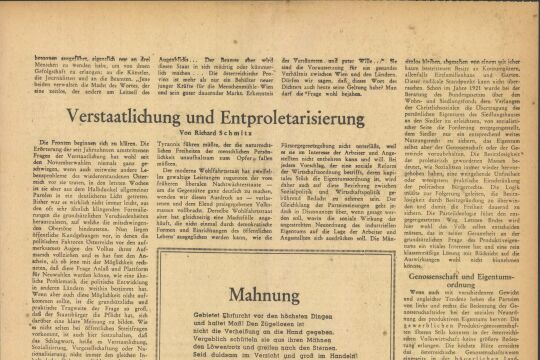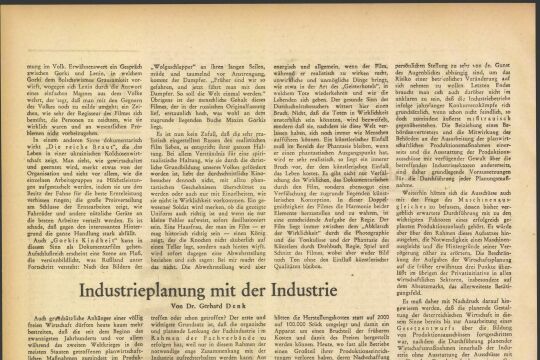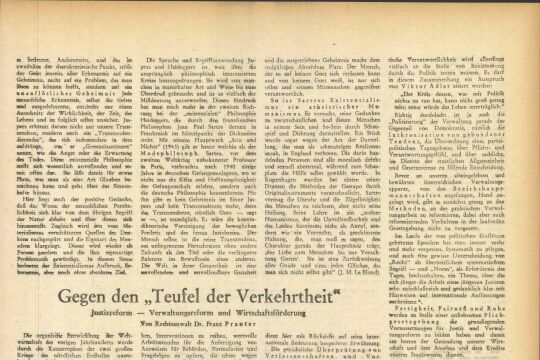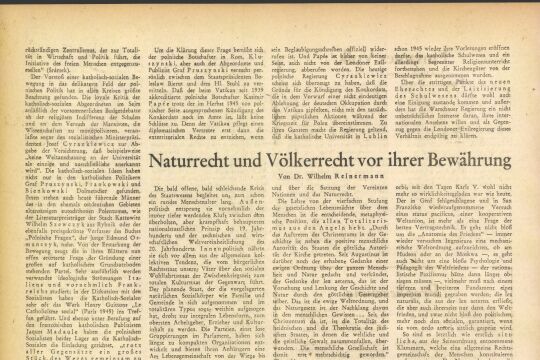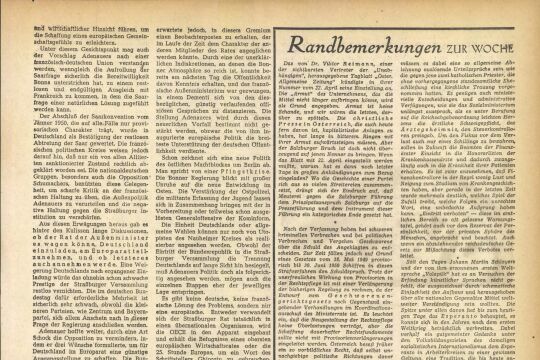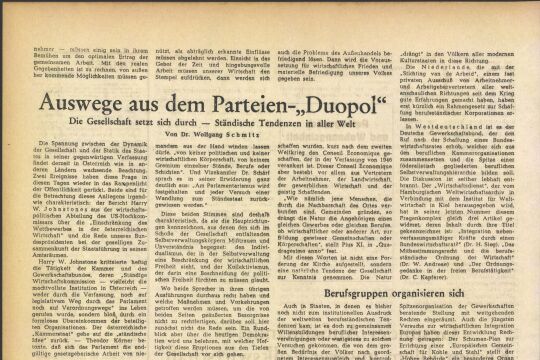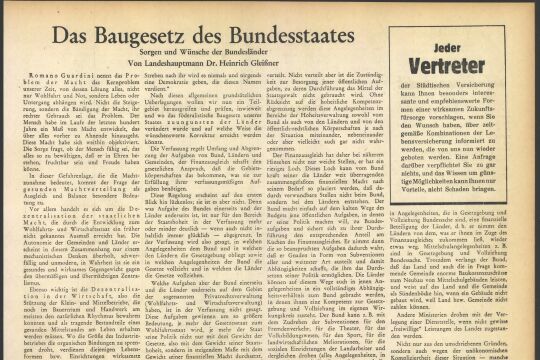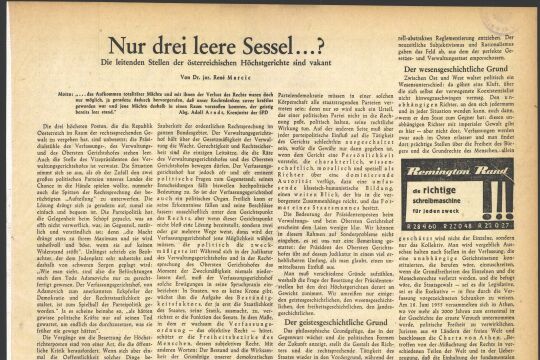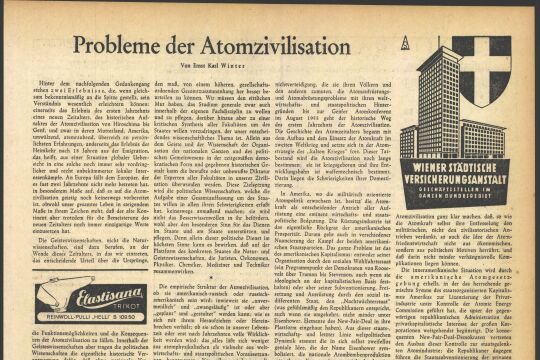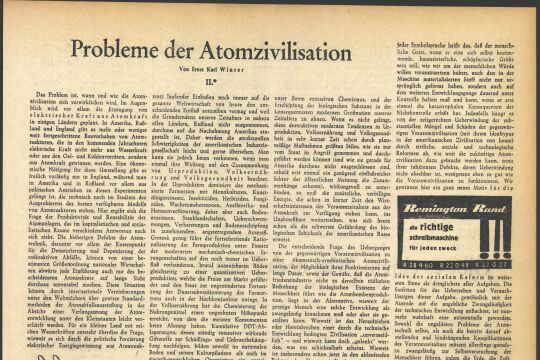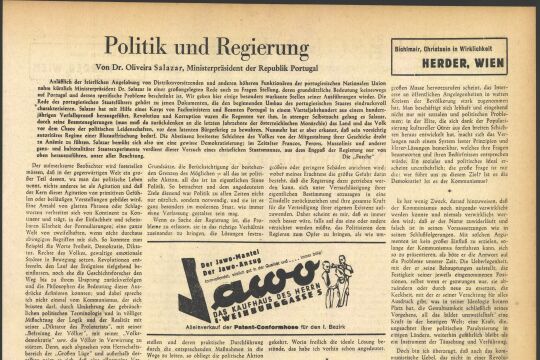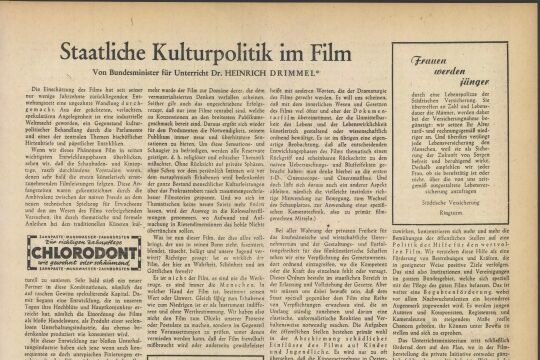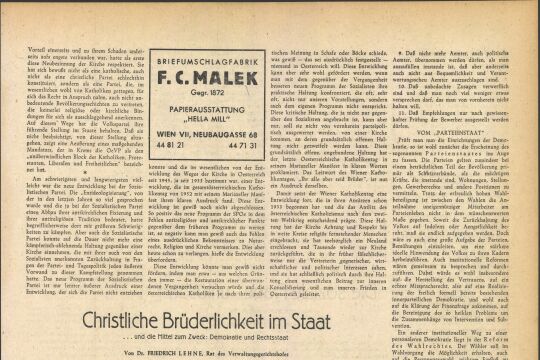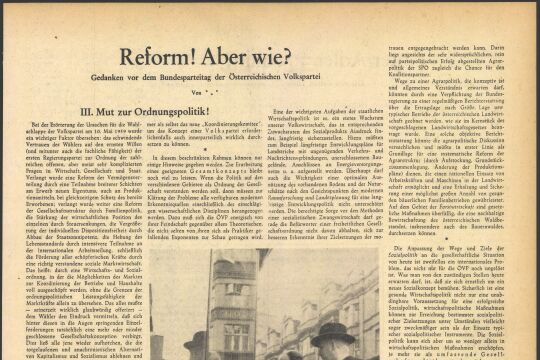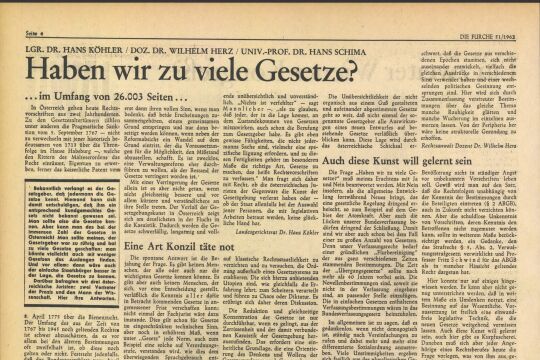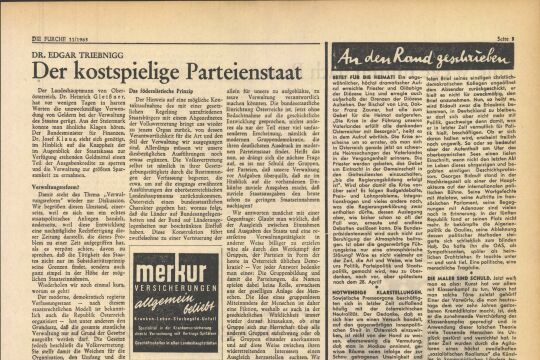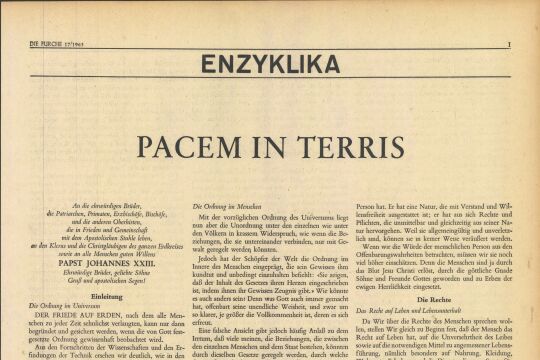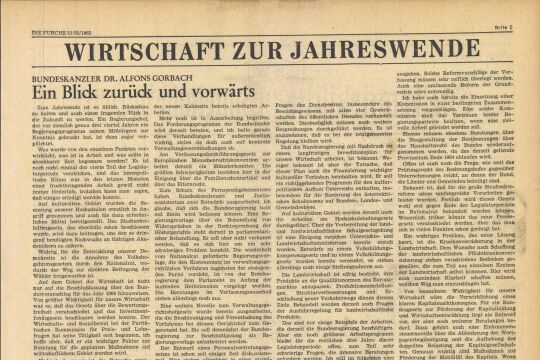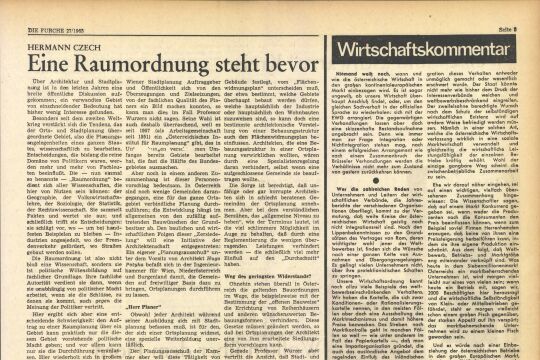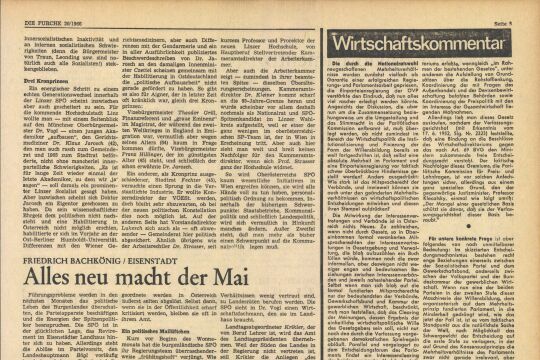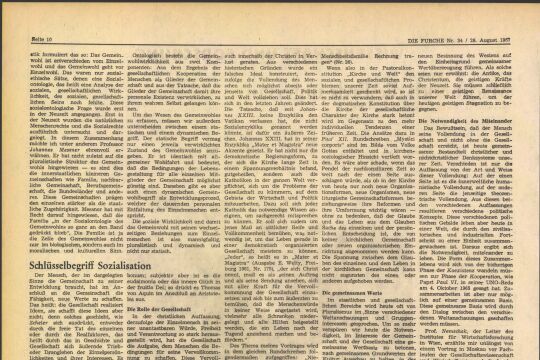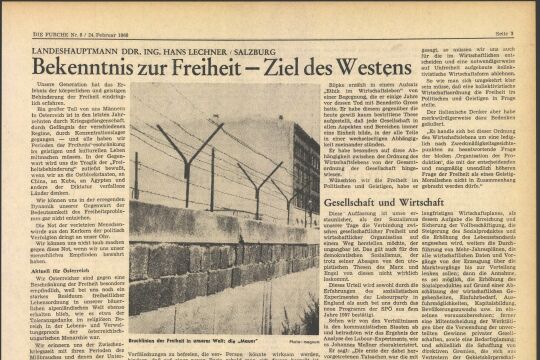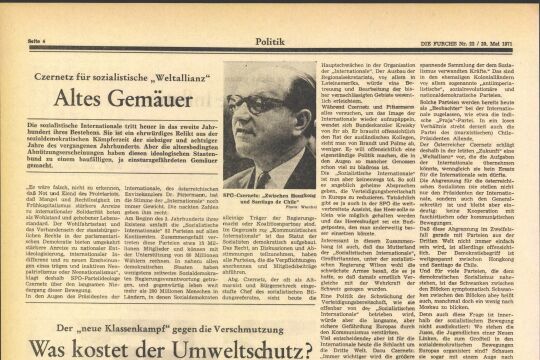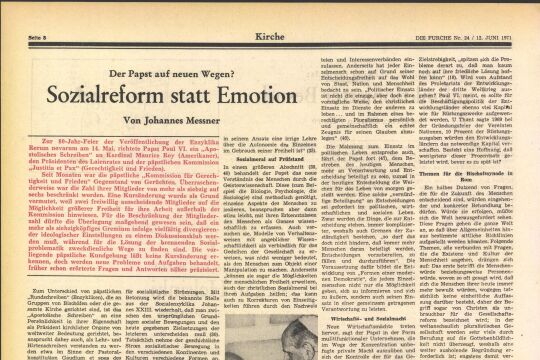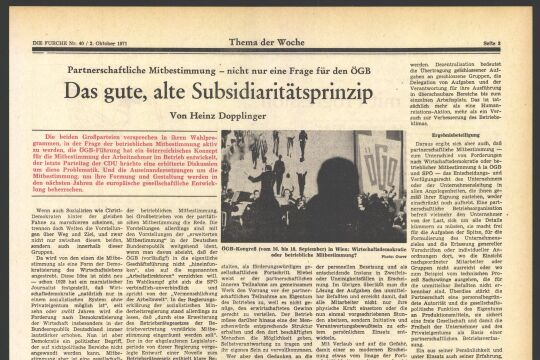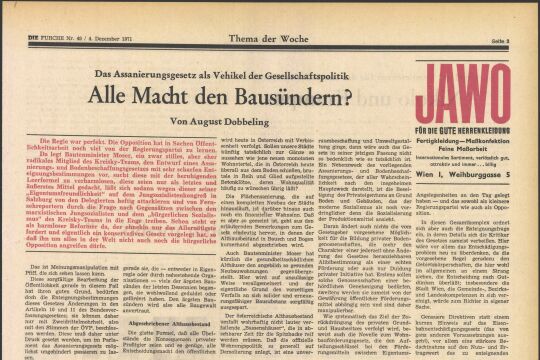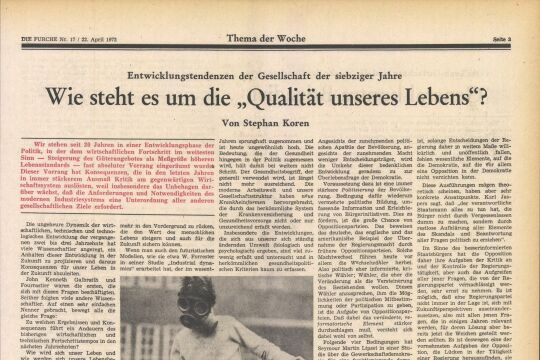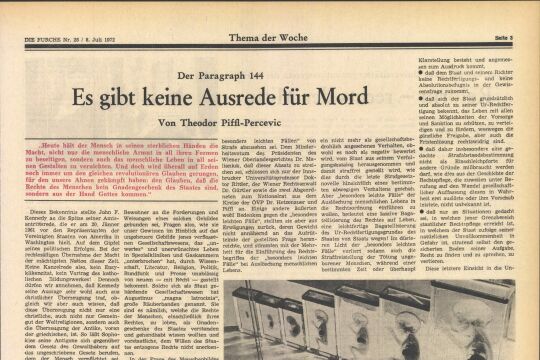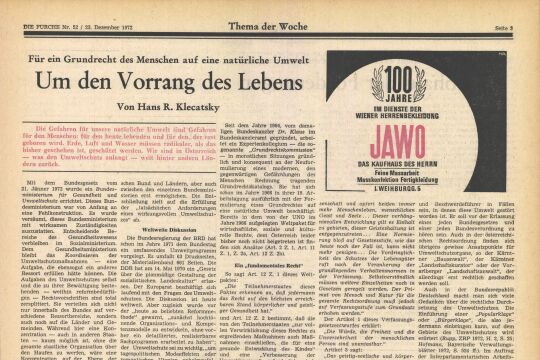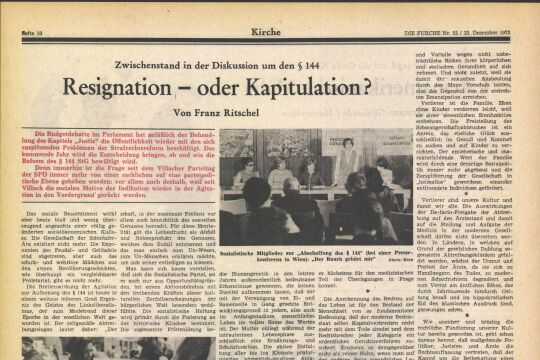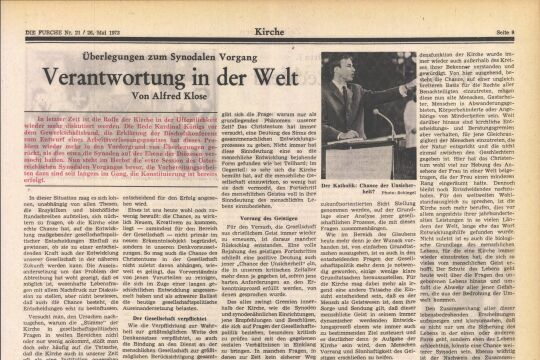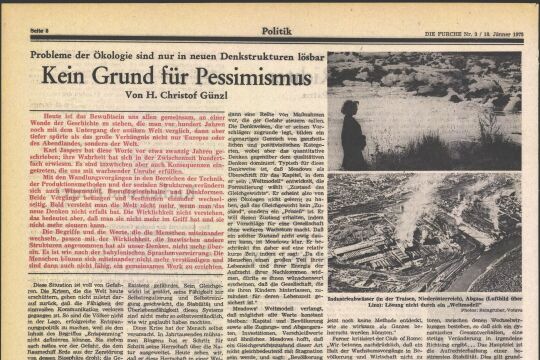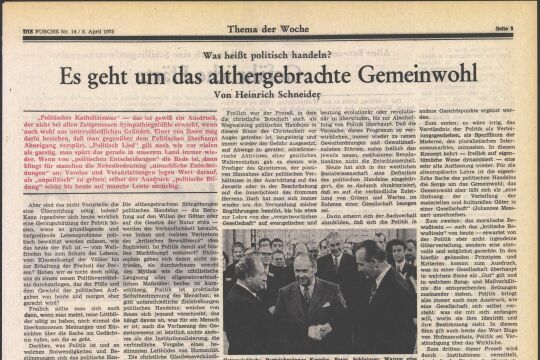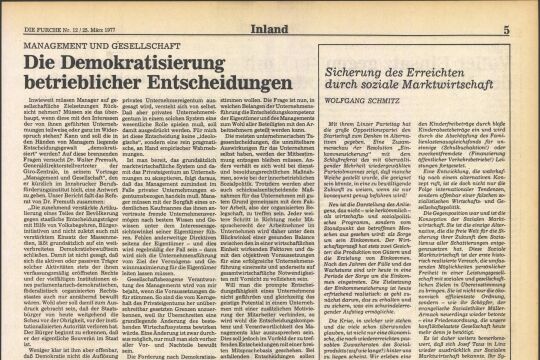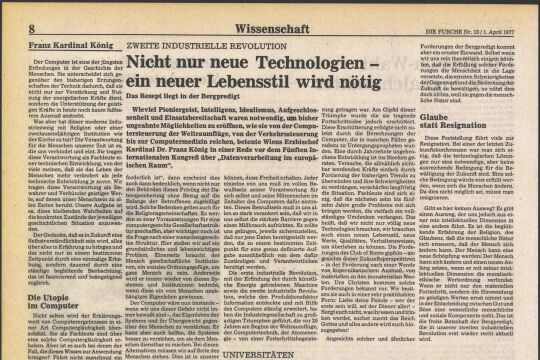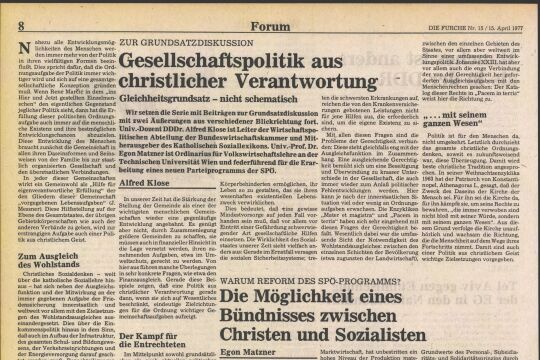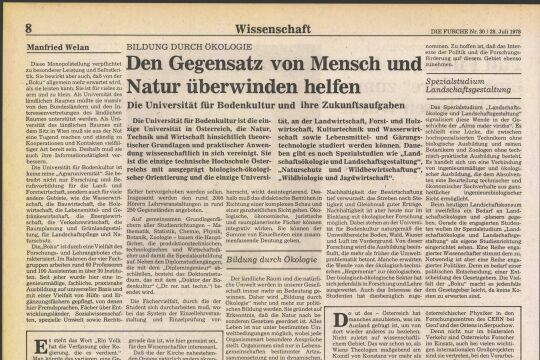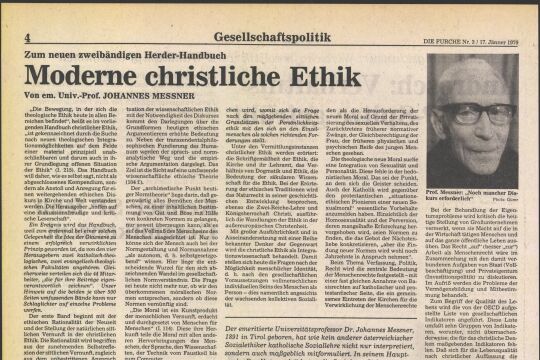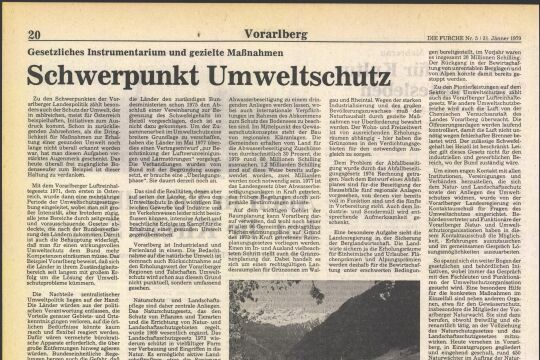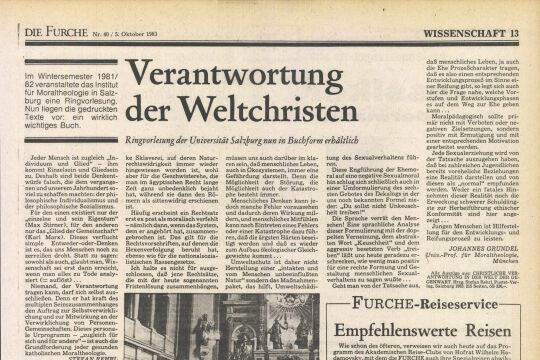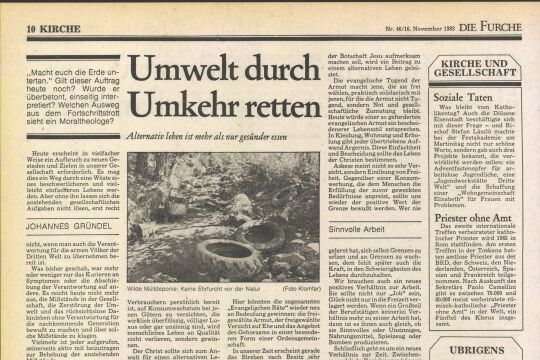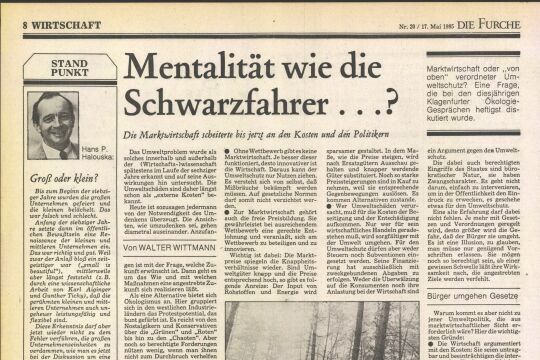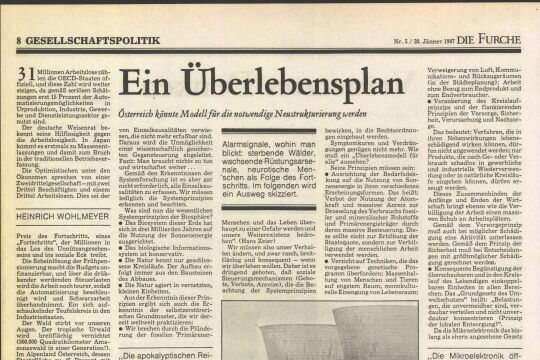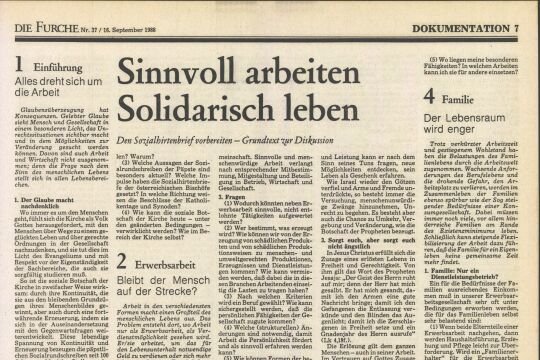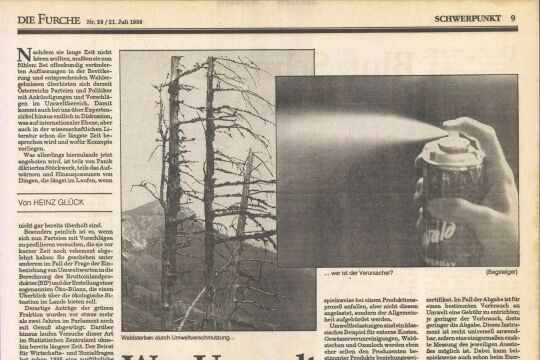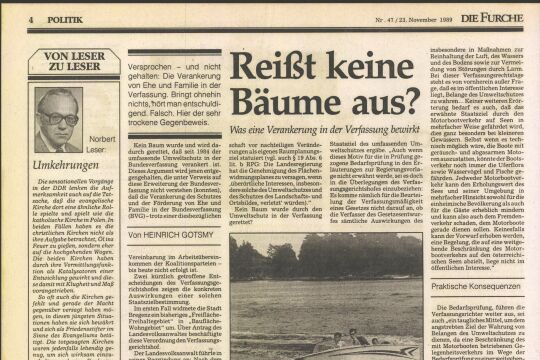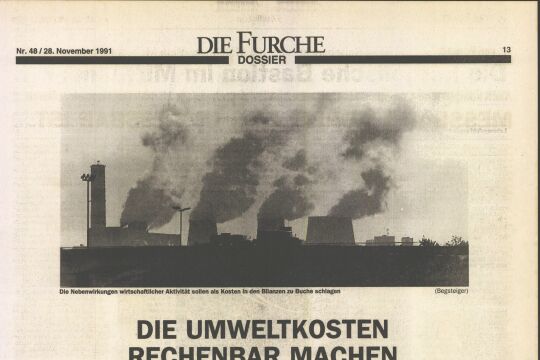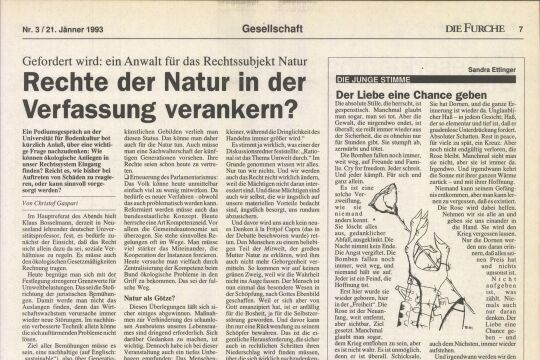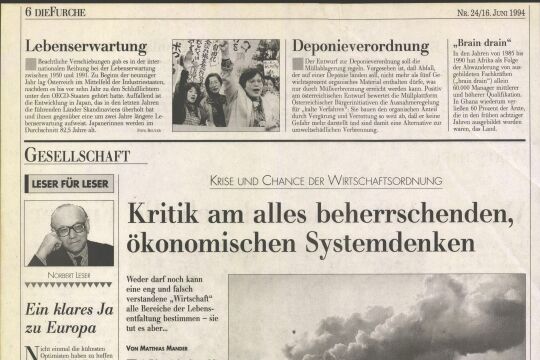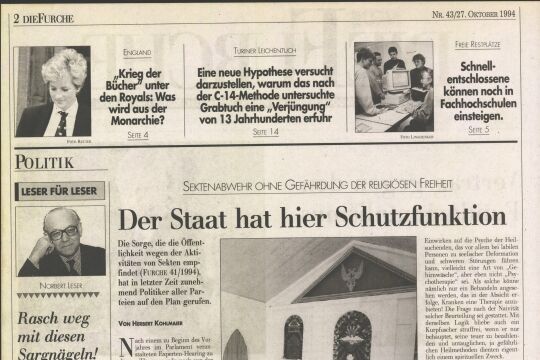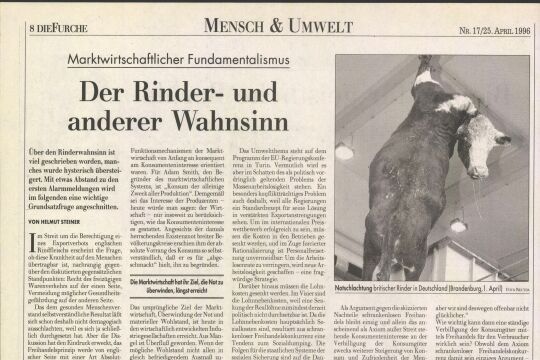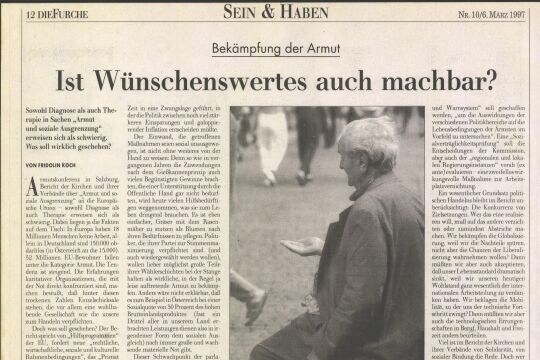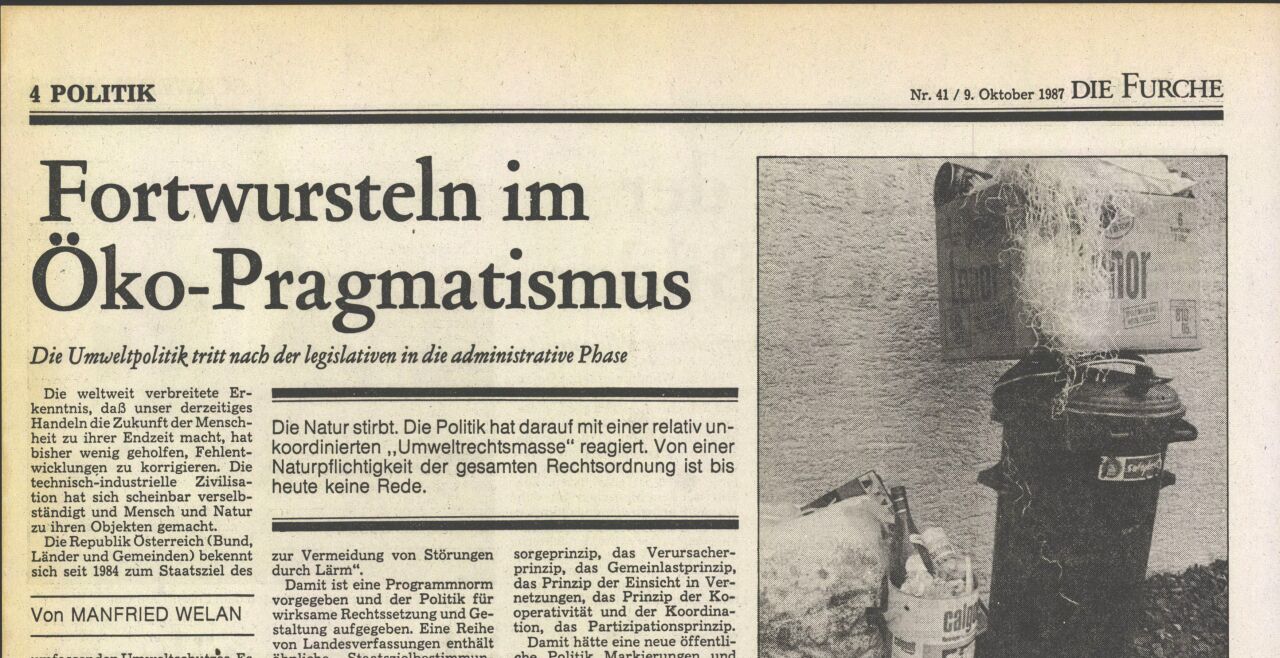
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Fortwursteln im Oko-Pragmatismus
Die Natur stirbt. Die Politik hat darauf mit einer relativ un-koordinierten „Umweltrechtsmasse“ reagiert. Von einer Naturpflichtigkeit der gesamten Rechtsordnung ist bis heute keine Rede.
Die Natur stirbt. Die Politik hat darauf mit einer relativ un-koordinierten „Umweltrechtsmasse“ reagiert. Von einer Naturpflichtigkeit der gesamten Rechtsordnung ist bis heute keine Rede.
Die weltweit verbreitete Erkenntnis, daß unser derzeitiges Handeln die Zukunft der Menschheit zu ihrer Endzeit macht, hat bisher wenig geholfen, Fehlentwicklungen zu korrigieren. Die technisch-industrielle Zivilisation hat sich scheinbar verselbständigt und Mensch und Natur zu ihren Objekten gemacht.
Die Republik Österreich (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich seit 1984 zum Staatsziel des umfassenden Umweltschutzes. Es .geht um die „Bewahrung der natürlichen Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen vor schädlichen Einwirkungen“. Der umfassende Umweltschutz besteht „insbesondere in Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, des Wassers und des Bodens sowie zur Vermeidung von Störungen durch Lärm“.
Damit ist eine Programmnorm vorgegeben und der Politik für wirksame Rechtssetzung und Gestaltung aufgegeben. Eine Reihe von Landesverfassungen enthält ähnliche Staatszielbestimmungen.
Durch die Umweltdoktrin wurden zur Verwirklichung des umfassenden Umweltschutzes Leit-büder, Grundkonzeptionen und politische Handlungsanweisungen gegeben. So sind zu beachten: das Nachsorgeprinzip, das Vorsorgeprinzip, das Verursacherprinzip, das Gemeinlastprinzip, das Prinzip der Einsicht in Vernetzungen, das Prinzip der Ko-operativität und der Koordination, das Partizipationsprinzip.
Damit hätte eine neue öffentliche Politik Markierungen und Orientierungen. Aus ihrer totalen Verantwortung hätte die Politik folgende Fragen aufzuwerfen: „Was kommt danach? Wohin wird es führen?“ und zugleich auch „Was ging vorher? Wie vereinigt sich das jetzt Geschehende mit dem ganzen Geworden-sein dieser Existenz?“
An diesen Fragen, zumindest aber an den Staatszielbestimmungen, sind die bestehenden Rechtsvorschriften und gesetzten Handlungen zu messen. Sie sind ein Maßstab für die Frage der Ausübung des Ermessens von Politik und Verwaltpng, das durch sie, wenn nicht Richtlinien, so doch Richtung erhält.
Planungen, Privatwirtschaftsverwaltung, Konfliktregelungen, Regierungserklärungen, Verwaltungsprogramme, aber auch Partei- und Verbändeprogramme hätten sich so neu zu orientieren.
Eine Konsequenz sollte sein, eine einheitliche Kompetenzgrundlage zumindest hinsichtlich der Nachsorge zu treffen. Alle bisherigen Erfahrungen begründen die Notwendigkeit dafür.
Die Rechtsordnung steht heute noch überwiegend im Dienste ökonomischer und sozialer Nützlichkeit. Erst in jüngerer Zeit ist die ökologische Tönung des Rechts stärker geworden.
Die Umorientierung wurde durch spezifische Verfassungsbestimmungen wie den umfassenden Umweltschutz sowie durch eine Fülle von Verwaltungsvorschriften versucht, die eine un-koordinierte und unsystematische „Umweltrechtsmasse“ bilden. Von einer „Naturpflichtigkeit“ der Rechtsordnung kann noch nicht die Rede sein.
Durch ihre herkömmlichen Regelungswerke und die mit ihnen zusammenhängenden sozialpolitischen Komplementär- und Konnexinstitutionen ist eine „ökono-mokratie“ festgeschrieben.
Die Zersplitterung, Spezialisierung und Kumulierung der Rechtsvorschriften verhindern oder behindern zumindest ganzheitliches, ökologischen Zusammenhängen folgendes Handeln in Politik und Verwaltung. Das Durcheinander, Nebeneinander und Nacheinander bei der Setzung und Durchsetzung des Rechts steht zu ganzheitlichem und an vernetzten Systemen orientiertem Denken in Widerspruch.
Die Segmentierung und Parzellierung der rechtlichen Teilordnungen, deren gesellschaftliches Gewicht durch Interessen und Klienten bestimmt ist, machen eine umfassende Langfristplanung in der Umweltpolitik fast unmöglich. So wird das praktisch-politisch Notwendige geradezu utopisch und der Pragmatismus des Fortwursteins in der Verwaltung von Strukturzwängen allein schon mühevoll.
Trotzdem wird Politik von der Natur selbst lernen müssen. Denn die Natur reagiert auf ihre Weise, ob es Politik, Verwaltung und Wirtschaft paßt oder nicht.
Durch das Bekenntnis zum umfassenden Umweltschutz hat sich die Republik selbst in die Pflicht - genommen Die Naturpflichtigkeit des Gemeinwesens ist erkannt und bekannt worden. Niemand kann sich mehr auf ein Bewußtseinsdefizit ausreden. Es besteht aber «in ordnungspolitisches Defizit.
Die Politik ist jetzt verpflichtet, jenen ordnungspolitischen Rahmen zu konzipieren und durch Rechtssetzung festzulegen, der die Produktion, Distribution und den Konsum ökosystemgerecht steuert.
Nach der Auffüllung von Lük-ken in der Gesetzgebung geht es rechtspolitisch vor allem um die Straffung und Systematisierung, um die Koordinierung und Konzentration des Rechtsmaterials, um Regelungs- und Vollzugsdefizite und -Zersplitterungen zu überwinden. Die Umweltpolitik tritt nach einer „legislativen“ in eine „administrative“ Phase.
Einrichtungen wie die Umweltverträglichkeitsprüfung, die Umweltanwaltschaft, die Planungsund Verwaltungspartizipation können den Kategorien der Allgemeinheit und der Gesamtheit von Raum- und Umweltbeziehungen angepaßt werden, um ganzheitliches und an vernetzten Systemen orientiertes Handeln zu ermöglichen.
Populär-Säumnisklagen und Staatshaftung bei Untätigkeit des Staates, auch bei Unterlassen der Gesetzgeber und Verordnungsgeber, Verbandsklagen beziehungsweise Beschwerden sind weitere rechtspolitische Themen.
Von besonderer Bedeutung ist rechtspolitisch das Abgehen von der Möglichkeit der Externalisie-rung von Kosten und ökologischen Folgen und das Hingehen auf eine Inter nalisierung ökologischer Risken in den einzelnen Wirtschaftsbereichen. Damit zu verbinden wäre die Einbindung der ökonomischen Kreisläufe in die Natur.
Das eine kann durch die ökologische Modernisierung des Anlagen- und Haftungsrechts erreicht werden, das andere durch eine generelle Regelung des In-Verkehr-Bringens von Erzeugnissen.
Die ökologische Krise hat die Diskussion um eine Rechtsfähigkeit der Natur und ihrer Schöpfungen im Ausland, insbesondere im angloamerikanischen Rechtsbereich, entfacht.
Die derzeitige Rechtsordnung findet für die Rechtssubjektivität des Menschen und bestimmter sozialer. Gebildein Form der juristischen Person keine Entsprechung bei der Natur. Diese wird nur in ihrer dienenden Funktion (die natürliche Lebensgrundlage des Menschen) wahrgenommen. In ihrer Gesamtheit und in ihren Teilen (Gewässer und Böden, Tiere und Pflanzen) ist sie nicht Rechtssubjekt, sondern Rechtsobjekt, Sache.
Obwohl in jüngster Zeit gefordert wird, die Natur auch um ihrer selbst willen zu schützen, ist daraus keine rechtspolitische Konsequenz gezogen worden. Der politisch geforderte Eigenwert bleibt in juristischen Deutungs- und Abwägungsvorgängen hängen und geht verloren.
Die Zeit- und Raumknappheit wird es in Zukunft zweckmäßig, ja vielleicht notwendig machen, zumindest eine beschränkte Rechtsfähigkeit der Natur und ihrer Teüe zu normieren.
Was heute wie eine Utopie klingen mag, ist vielleicht morgen schon eine Notwendigkeit, die wie andere Fragen der Rechtspersönlichkeit in der Geschichte pragmatisch gelöst wird.
Wenn dem Eigenwert der Natur mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit entsprochen wird, wird die kostenlose Nutzung von Luft, Wasser und Boden ebensowenig denkbar wie eine Vermutung der Umweltverträglichkeit.
Die allgemeine Betätigungsfreiheit und freie Entfaltung der Persönlichkeit würden an den Rechten der natürlichen Umwelt wie an den Rechten anderer ihre Grenzen finden.
Mit der Anerkennung der Rechtspersönlichkeit der Natur und dem Eigenwert der Natur im Verfassungsrang würden naturwissenschaftliche und philosophische Überlegungen rechtlich nachvollzogen werden. Damit begänne der Ubergang vom anthropozentrischen zum ökozentri-schen Recht.
Der Autor ist Professor für Rechtslehre an der Universität für Bodenkultur und ÖVP-Stadtrat in Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!