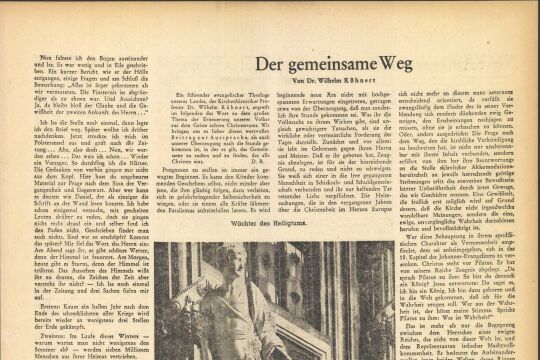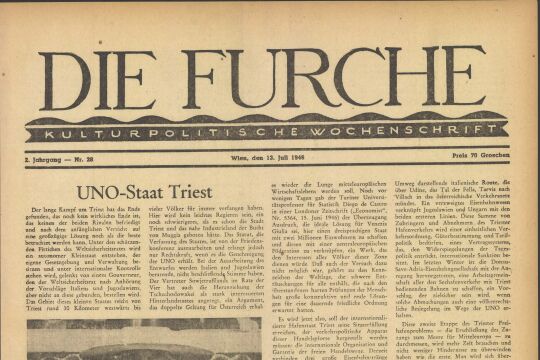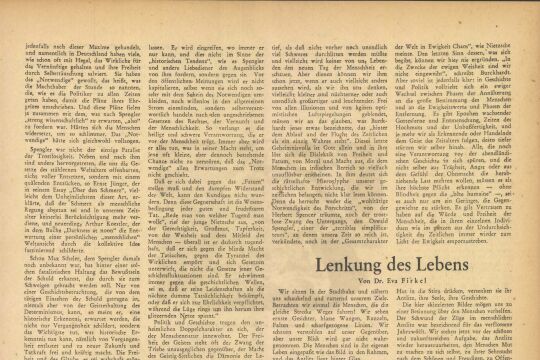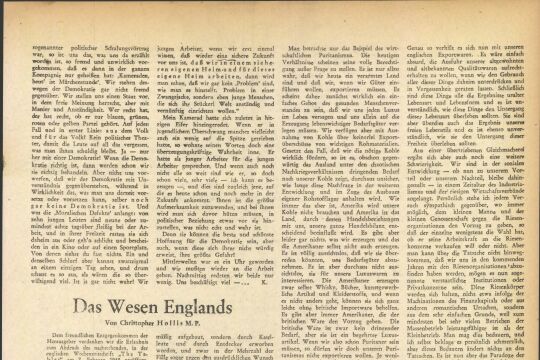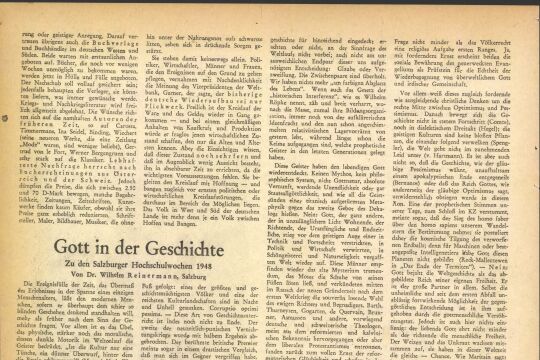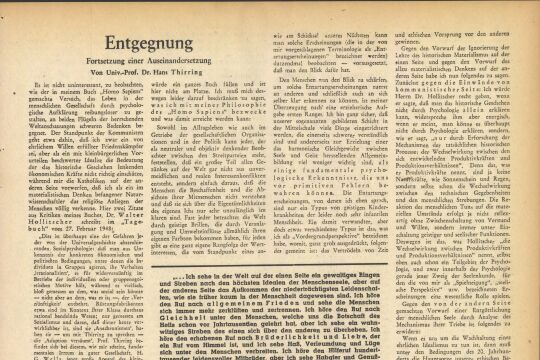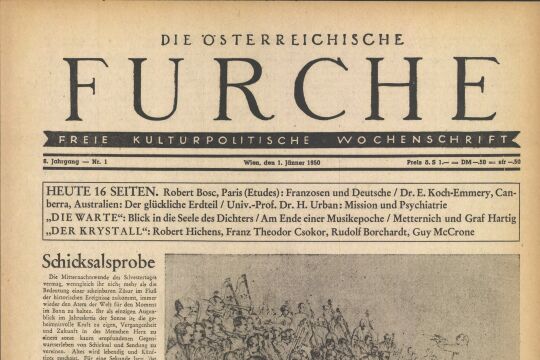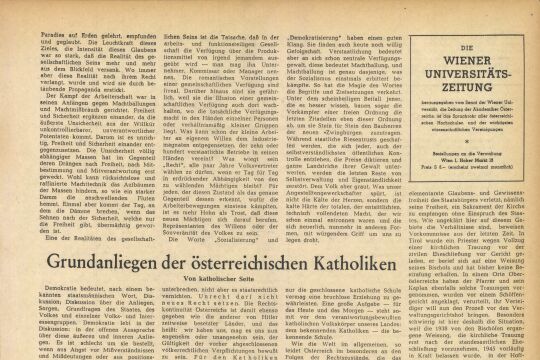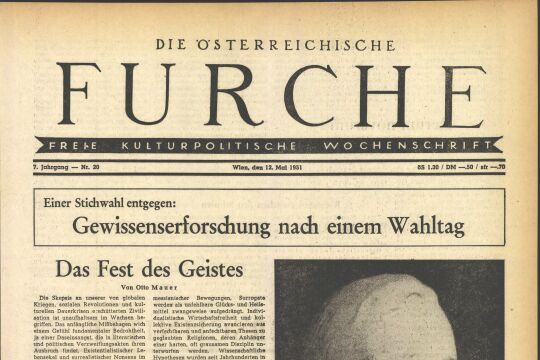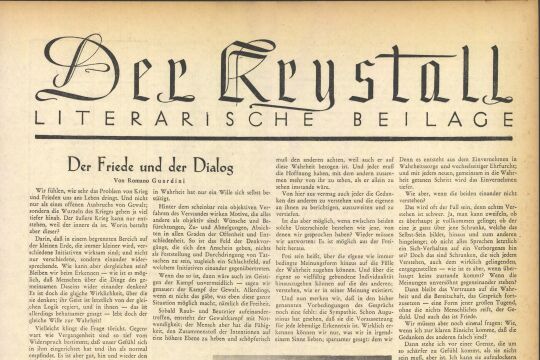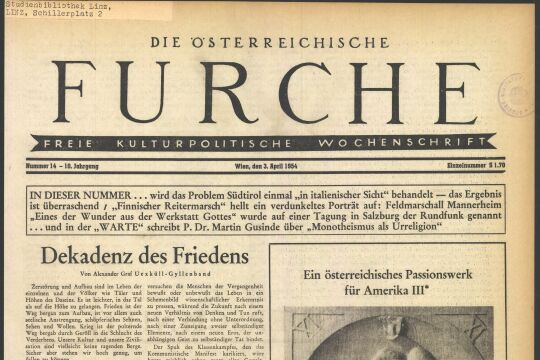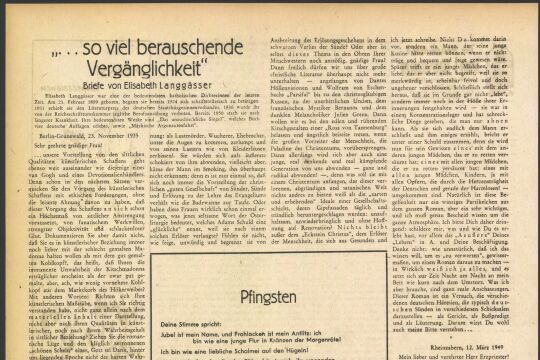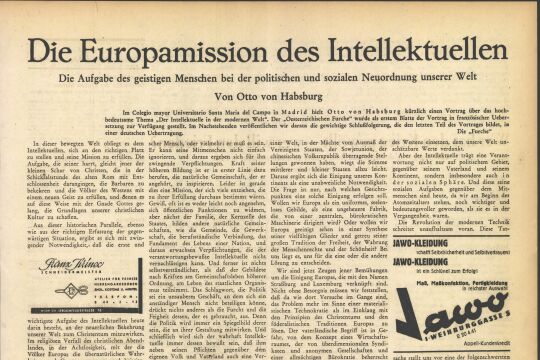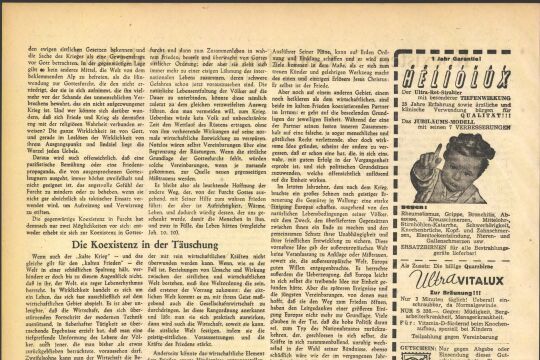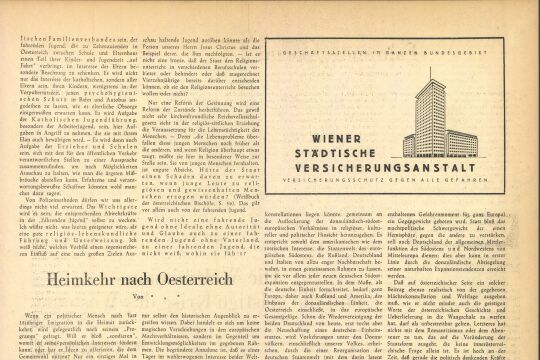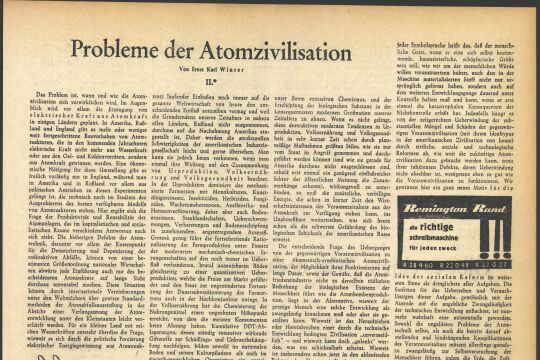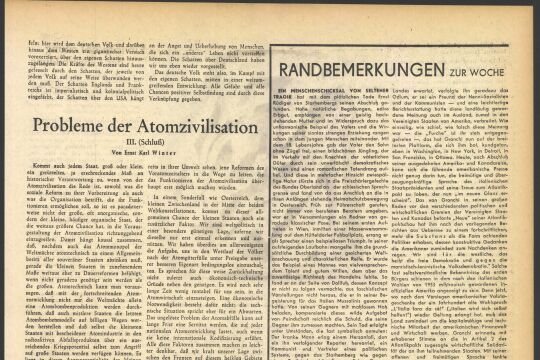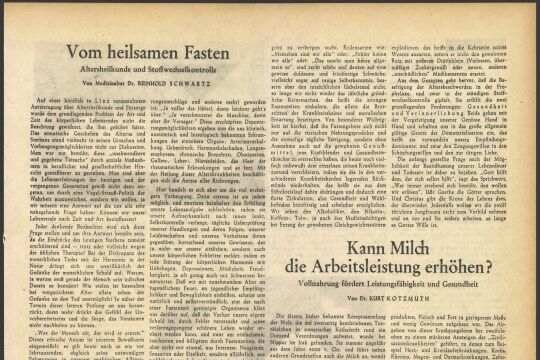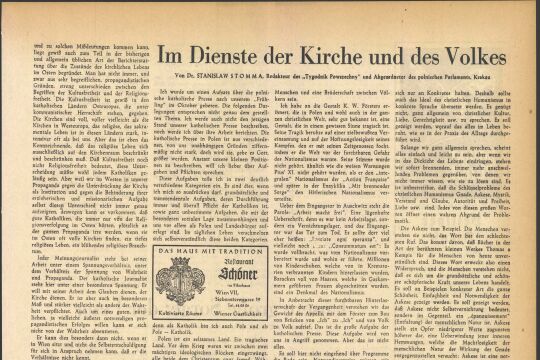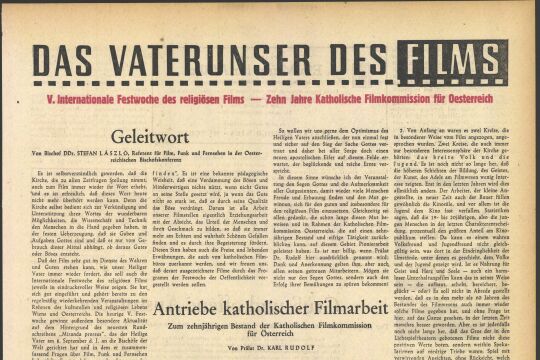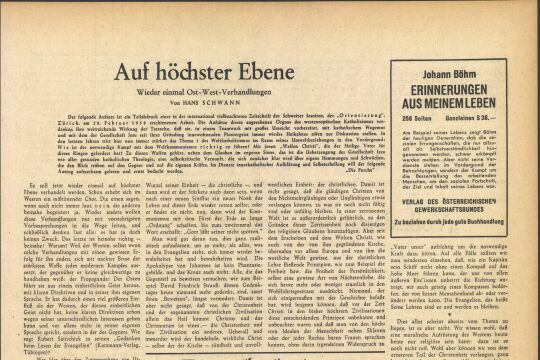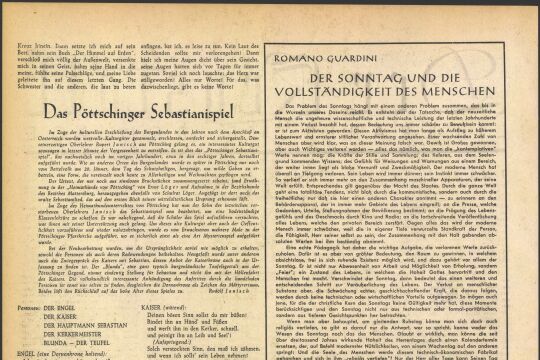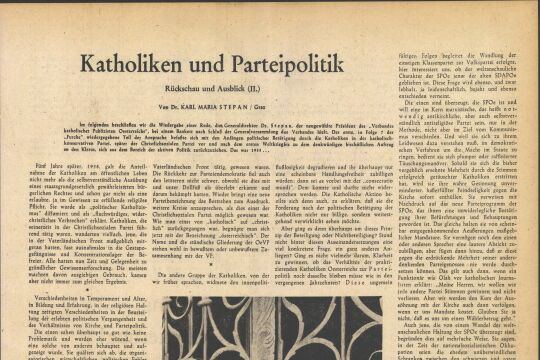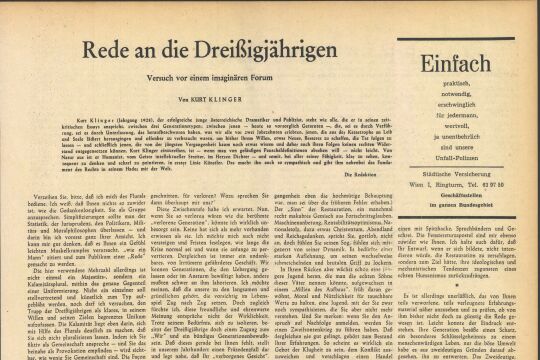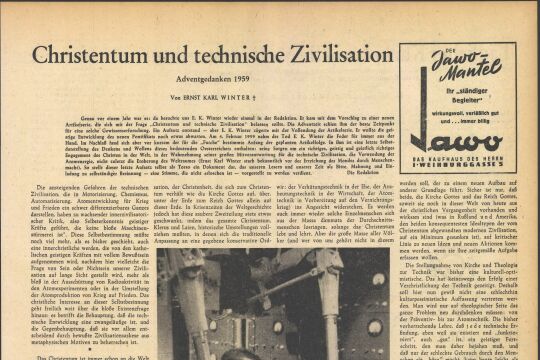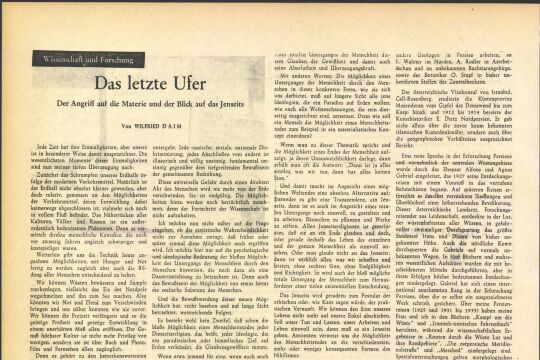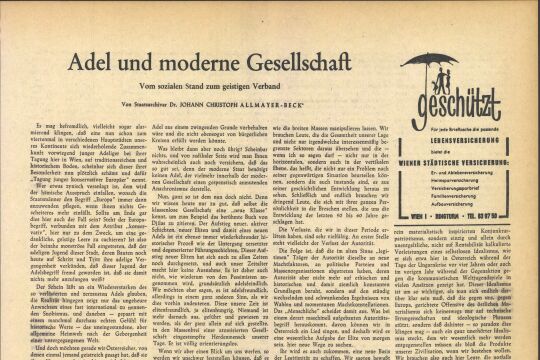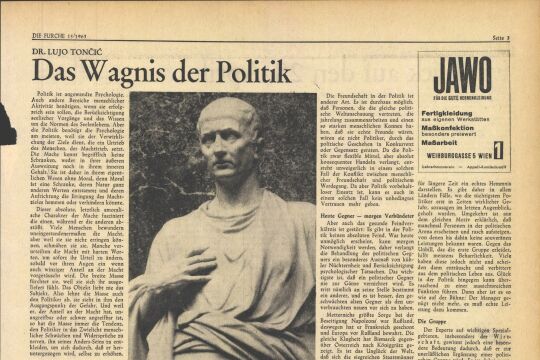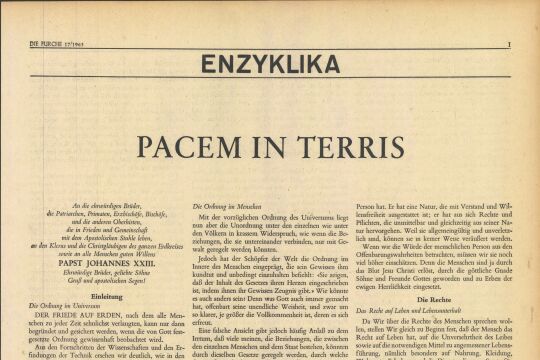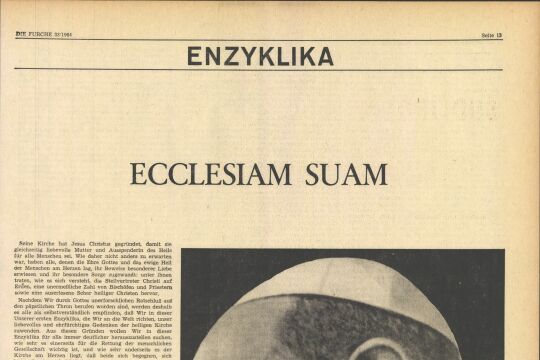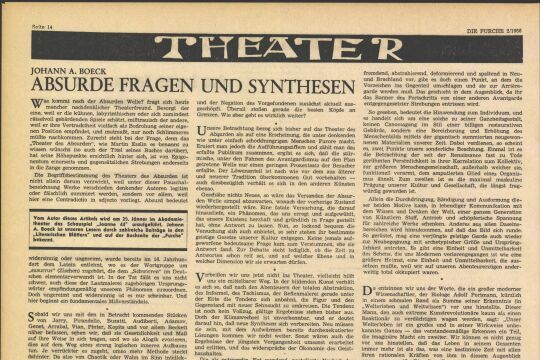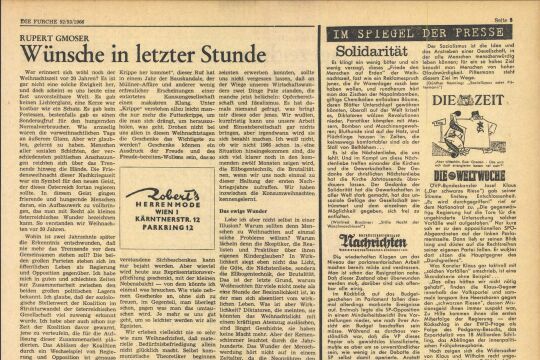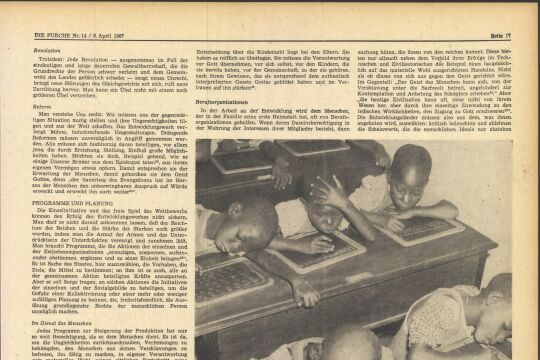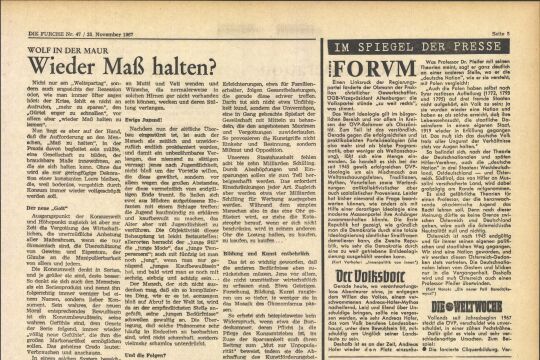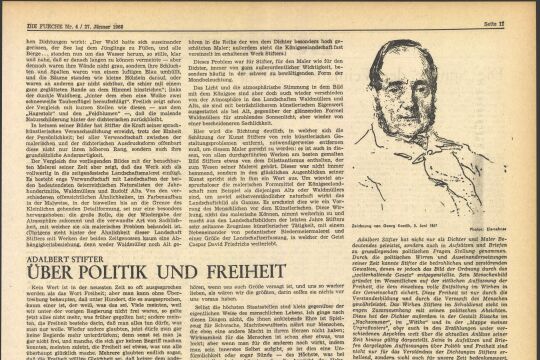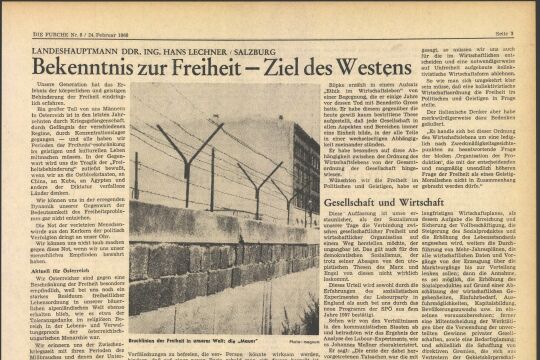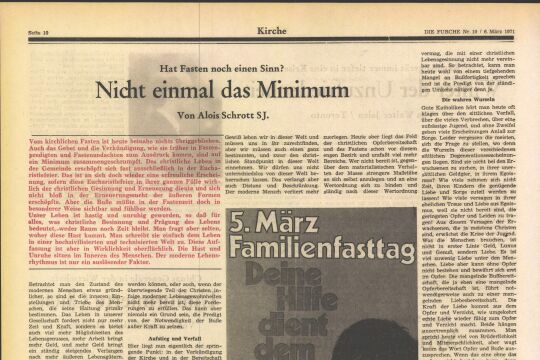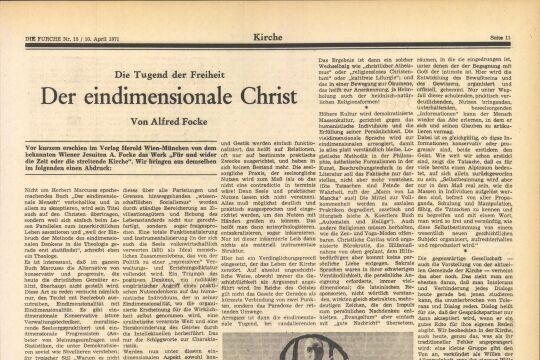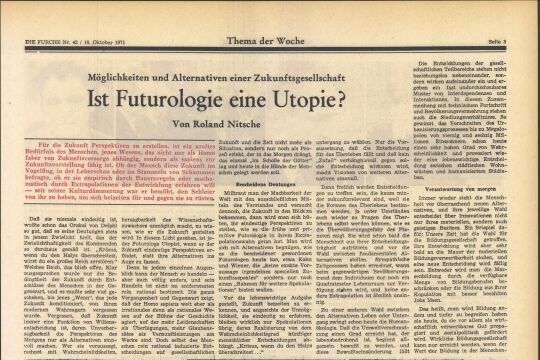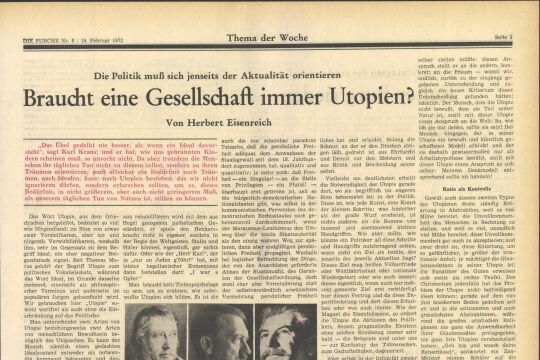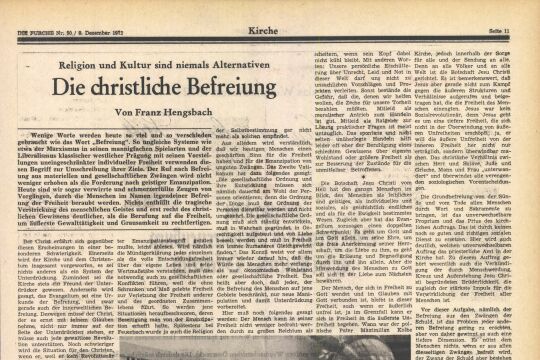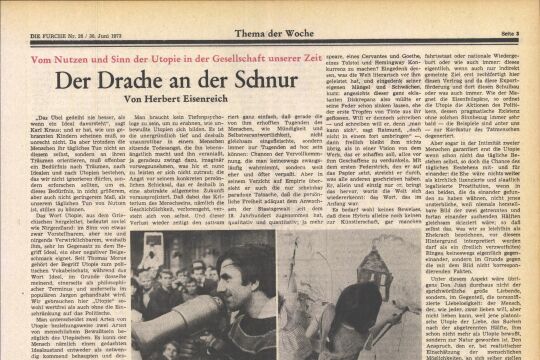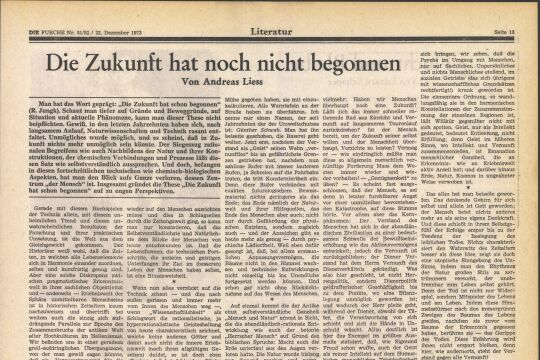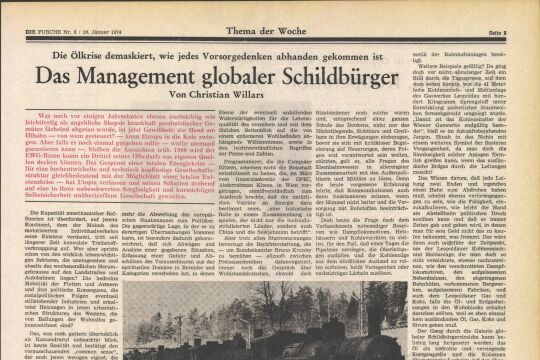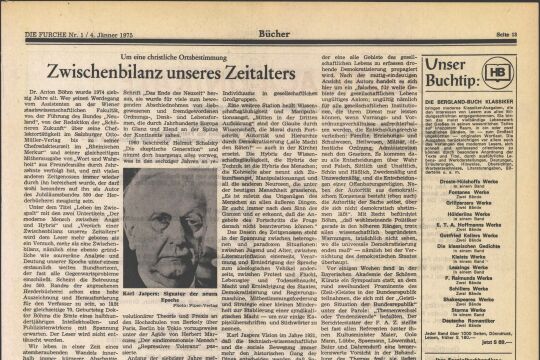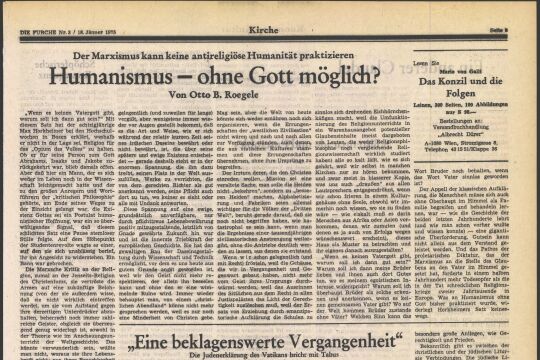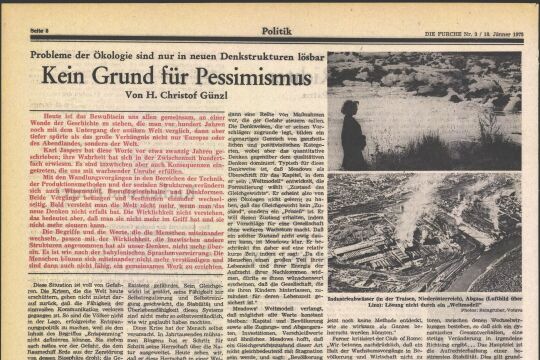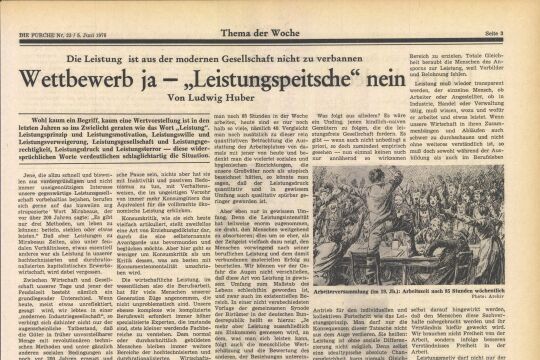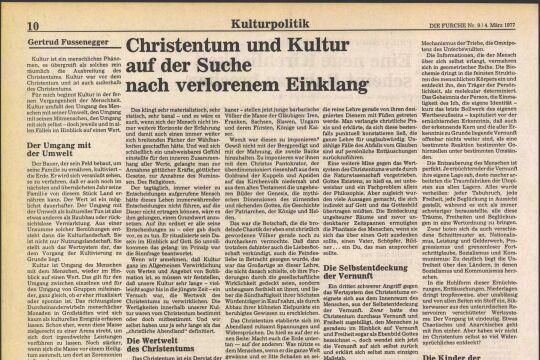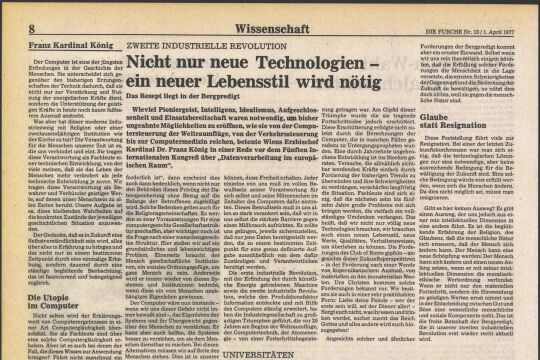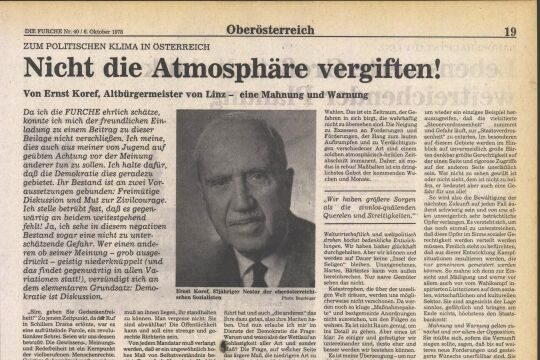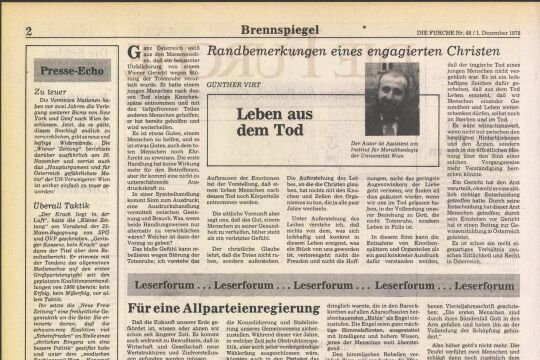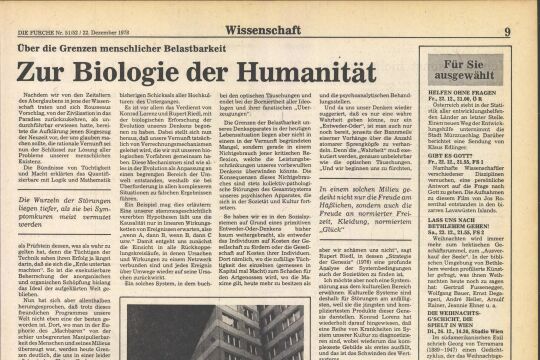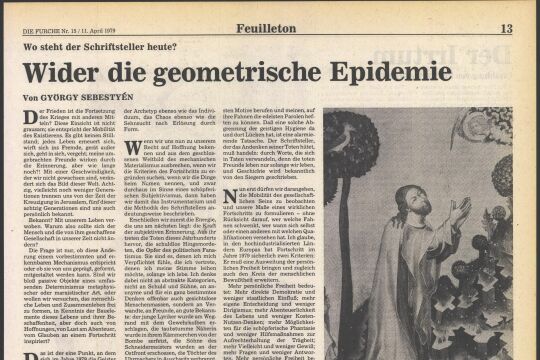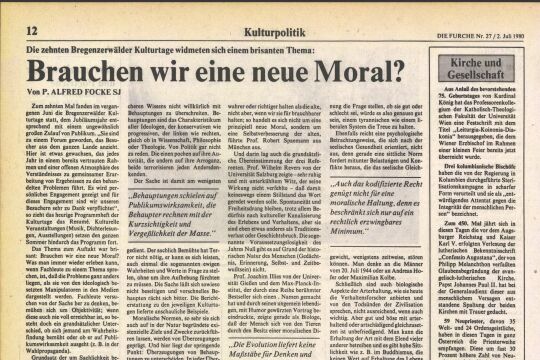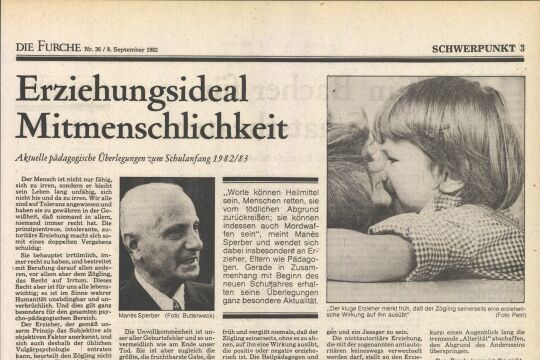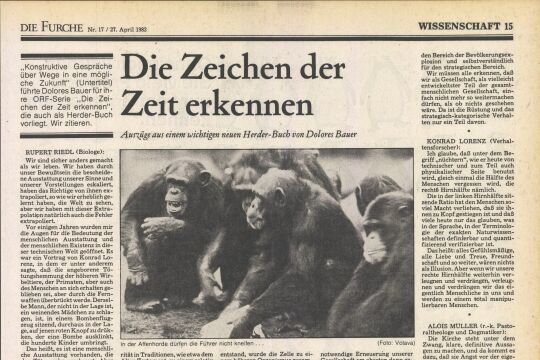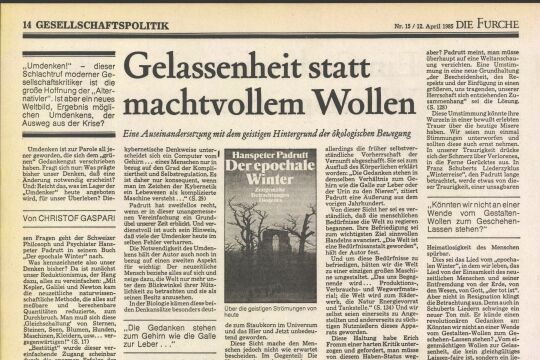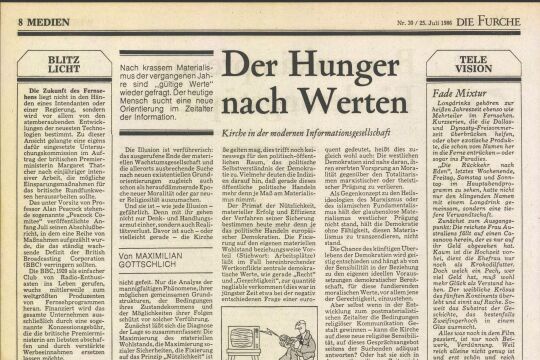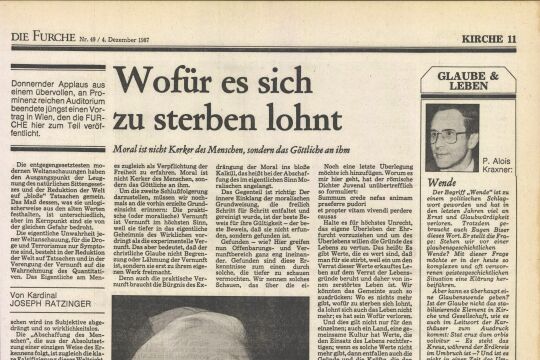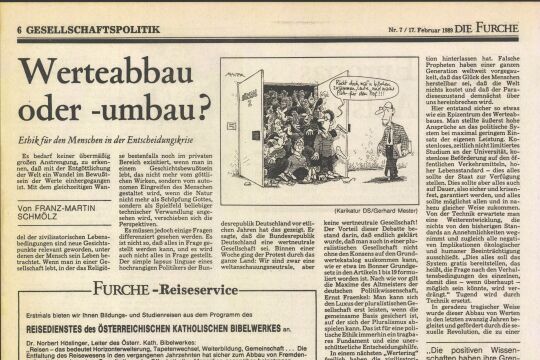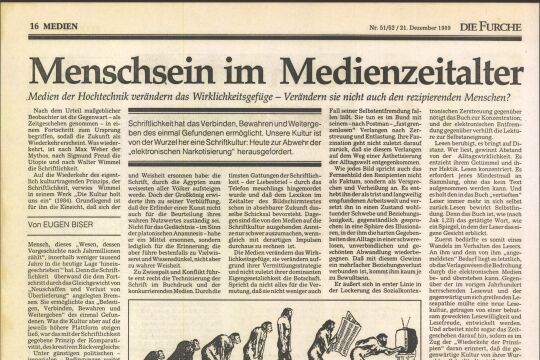Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
die Zukunft: hier drücken
„Die Kultivierung der Furcht wird heute geradezu zur ethischen Pflicht.“
kraft dem Nachdenklichen zur Wahl stellt. Besseres habe ich leider nicht zu bieten. Vielleicht wird eine künftige Metaphysik es können.
Doch zurück zur Sache. Beide von uns genannten Drohungen — die der physischen Vernichtung und die der existenziellen Verkümmerung — birgt die moderne Großtechnik in ihrem Schoß: die eine durch ihr geradewegs negatives Katastrophenpotential (wie den Atomkrieg), die andere durch ihr positives Manipulationspotential, das zum Beispiel durch Automatisierung aller Arbeit, psychologische und biologische Verhaltenskontrolle, totale Herrschaftsformen, wenn nicht gar durch genetisches Umkonditio-nieren unserer Natur, zur ethischen Entmüdung führen kann.
Damit sind wir zurückgekehrt zu dem bereits besprochenen sachhaltigen Wissen der .Futurologie'. Von ihm sagten wir, es müsse das rechte Gefühl in uns wachrufen, um uns zum Handeln im Sinne der Verantwortung zu bewegen. Das rechte Gefühl nun ist in unserem Fall in großem Umfange die Furcht.
Sie gewinnt für uns Heutige einen neuen moralischen Wert. Früher von geringem Ansehen unter den Emotionen, eine Schwäche der Furchtsamen, muß sie jetzt zu Ehren gebracht werden, und ihre Kultivierung wird geradezu zur ethischen Pflicht.
Die erstmals uns treffende diesseitige Verantwortung für die Menschheit ist es, die uns die richtige Furcht zur Pflicht macht und zur täglichen Übung. Noch manche andere Umwertung früherer Werte folgt daraus.
Früher wurde der Wagemutige gepriesen, der Vorsichtige ein wenig verachtet. Für den einzelnen in seiner Sphäre mag das weiter gelten. Für die Allgemeinheit aber ist mit dem enormen Ausmaß dessen, was inzwischen auf dem Spiele steht und wofür unsere Nachkommen dereinst zahlen müssen, Vorsicht zur höheren Tugend geworden.
Wie betätigt sich die von der Verantwortung uns neuerdings auferlegte Vorsicht? Letztlich in einer neuen Bescheidenheit der Zielsetzungen, der Erwartungen und der Lebensführung.
Was die einzelnen Risikoprüfungen betrifft, so habe ich eine Faustregel für die Behandlung der Ungewißheit vorgeschlagen: in dubio pro malo — wenn im Zweifel, gib der schlimmeren Prognose vor der besseren Gehör.
Mit vielem aber sind wir schon in der gar nicht mehr ungewissen Gefahrenzone mitten drin, wo die neue Bescheidenheit nicht mehr zur Sache weitausschauender Vorsicht, sondern schon naher Dringlichkeit ist. Um die in vollem Lauf begriffene Ausplünderung, Artenverarmung und Verschmutzung des Planeten aufzuhalten, der Erschöpfung seiner Vorräte vorzubeugen, sogar einer mensch-verursachten, unheilvollen Veränderung des Weltklimas, ist eine neue Frugalität in unseren Konsumgewohnheiten vonnöten.
„Frugalität“: da wären wir bei einem recht alten und erst jüngst aus der Mode gekommenen Wert. Enthaltsamkeit und Mäßigkeit waren durch lange Vorzeiten des Abendlandes obligate Tugenden der Person, und die „Völlerei“ steht groß im kirchlichen Katalog der Laster.
Die jetzt neu geforderte Frugalität hat damit und auch mit persönlicher Vollkommenheit überhaupt nichts mehr zu tun. Gefor-r dert ist sie im Weitblick auf die Erhaltung des terrestrischen Gesamthaushaltes. Sie ist also eine Facette der Ethik der Zukunftsverantwortung.
Welche Aussicht hat dieser Ruf nach Frugalität, sich durchzusetzen, bevor die schließlich über uns hereinbrechende Kargheit zu viel Schlimmerem nötigt?
Es gibt den Weg des freiwilligen Konsensus und den des gesetzlichen Zwangs. Der erste, der weit vorzuziehen ist, aber nicht mehr auf die Macht der Religion rechnen kann, ist nur gangbar, wenn das gewünschte Verzichtverhalten durch die Macht der Sitte zur gesellschaftlichen Norm erhoben wird, woran der einzelne sich auch ohne Einsicht in ihren Sinn und gewohnheitsmäßig im ganzen hält.
Der andere Weg wäre die zeitige Erzwingung der Frugalität von oben her, durchs öffentliche Gesetz und seine Sanktionen. Auch dafür sind die Aussichten im demokratischen Stimmverfahren nicht gut. Es wird ja durchwegs von gegenwärtigen Interessen und Umständen beherrscht und läßt sich schwerlich, solange kein Mangel da ist, vom fernhin prophezeiten Mangel bewegen.
Also müßte die nötige Gesetzgebung autoritär zustande kommen, als Teil einer veränderten politischen Ordnung, was im Namen der Freiheit zu beklagen wäre.
Ganz neuen Boden betreten wir, wenn wir von der Zügelung der Genußgier zur Zügelung des Könnens und Leistens, zur Bändigung des Vollbringungstriebes übergehen. Wer hätte je im Allgemeininteresse „Mäßigung“ in der Anstrebung menschlicher Höchstleistungen empfohlen? Es war Tugend, zu tun, was man kann, um das Gute mit dem Besseren zu übertreffen, alles Können zu vermehren, immer mehr und größeres zu vollbringen.
Grenzen zu setzen und haltzumachen wissen selbst in dem, worauf wir mit Grund am stolzesten sind, kann ein ganz neuer Wert in der Welt von morgen sein. Vielleicht müssen wir vom Maßhalten im Gebrauch der Macht, das immer ratsam war, zum Maßhalten im Erwerb der Macht fortschreiten. Denn überall werden Punkte erreicht, wo der Besitz der Macht die fast unwiderstehliche Versuchung ist, sie zu gebrauchen, ihr Gebrauch aber gefährlich, verderblich, mindestens ganz unabsehbar in den Folgen sein kann.
Darum wäre es besser, die betreffende Macht gar nicht erst zu besitzen.
Es gibt neuerdings Technologien, die auch den Menschen direkt zum Gegenstand haben und das Sein von Personen betreffen. Da erheben sich qualitative Fragen. Die „Machbarkeiten“, die hier schon aktuell werden oder erst winken, betreffen den Anfang und das Ende unseres Daseins, unser Geborenwerden, unsere Lebenslänge und unser Sterben, ja, unsere erbliche Konstitution. Sie rühren damit an letzte Fragen unseres Menschseins: an den Begriff des ,bonum humanüm*, den Sinn von Leben und Tod, die Würde der Person, die Integrität des Menschenbildes (religiös: imago Dei)_.
Auf solche Fragen müssen wir im Lichte eines gültigen (nicht nur gerade geltenden) Menschen-büdes antworten, und dafür brauchen wir wiederum die Metaphysik - diesmal nicht eine nur formale, sondern eine materiale, inhaltliche Metaphysik, die das so zu verantwortende Sein vor ganz konkreten Entstellungen schützt.
In ihrem Lichte können wir Fragen der Humantechnologie auch antizipierend angehen, und zwar kategorisch, frei vom hypothetischen Rätselspiel der Zahlen und der verschlungenen Weltkausalitäten, welche die Wirkung unseres Tuns im Großen beherrschen.
Die bloße Faustregel der .Heuristik der Furcht', bei schwankenden Prognosen der warnenden Gehör zu geben, wird hier ersetzt durch das sichere, von Größenberechnung der Folgen ganz unabhängige Urteil, daß dies oder jenes - ob in großem oder kleinem Maßstab — schlechterdings nicht stattfinden darf. Wenn etwa das Spielen mit der menschlichen Erbsubstanz als solches ein Frevel ist, dann ist es dies schon beim ersten und einzigen Versuch und nicht erst bei der Massenanwendung, die sonst wohl in der Erwägung technologischer Verwüstungen und auch biologischer Wagnisse maßgebend ist. Dann aber stünde es schon der Forschimg nicht frei, solche Versuche anzustellen.
Hören wir, was Edmund Burke im späten 18. Jahrhundert sagte: „Die Gesellschaft kann nicht bestehen, ohne daß eine kontrollierende Macht über Wollen und Begehren irgendwo errichtet ist. Und je weniger davon innen ist, desto mehr muß außen sein. Es steht geschrieben in der ewigen Verfassung der Dinge, daß Menschen von zügellosem Geist nicht frei sein können. Leidenschaften schmieden ihre Fesseln.“
Es liegt an uns, die Notwendigkeit der Tyrannei zu vermeiden, indem wir uns in die Hand nehmen und wieder strenger mit uns selbst werden. Freiwillige Opfer an Freiheit jetzt können die Hauptsache davon für später retten.
Da wir alle Mittäter am System sind, indem wir von ihm und den Früchten seines Raubbaus zehren, können wir alle — jeder von uns - etwas zur Änderung seiner Bedrohlichkeit tun, indem wir unseren Lebensstil ändern. Es ist nicht zu früh dazu — aber, sagen wir es laut gegen allen lähmenden Fatalismus: noch nicht zu spät! Der Autor ist vor allem bekannt durch sein Werk Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation“ (1979), sein Beitrag ein Auszug aus einem am 21. Oktober im Festsaal der Universität Wien gehaltenen Vortrag.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!