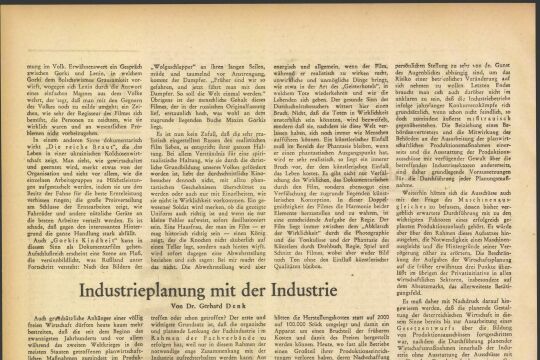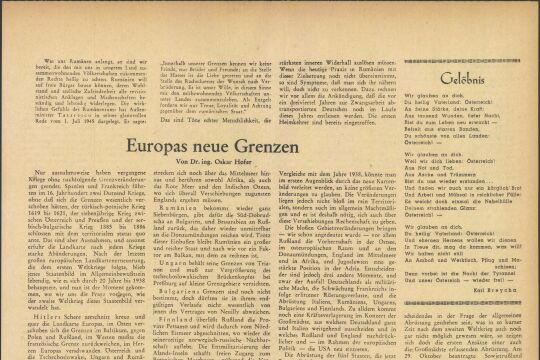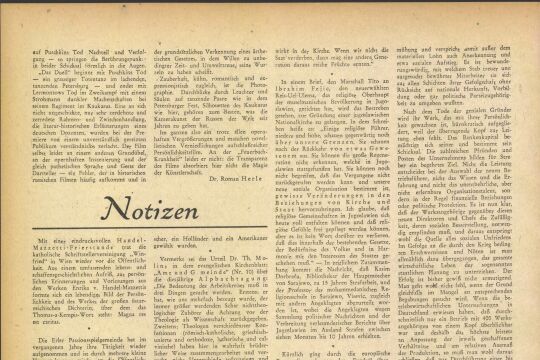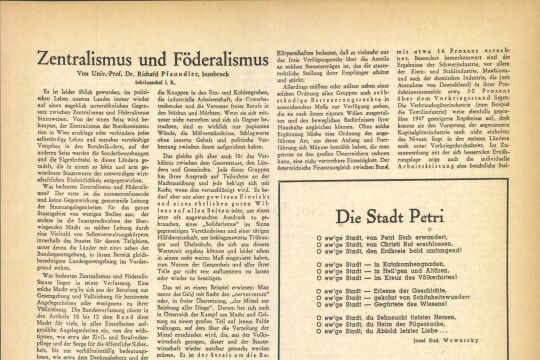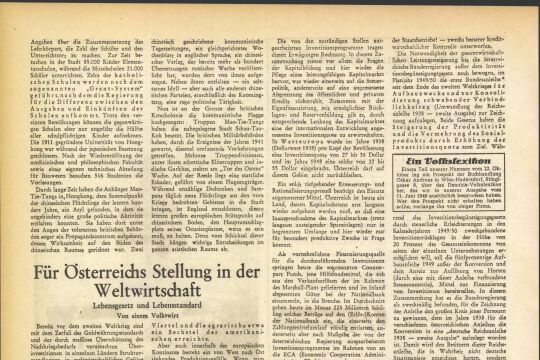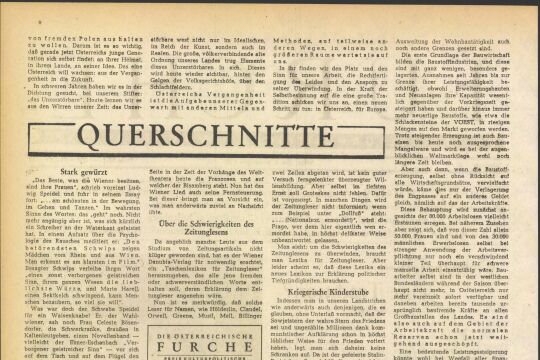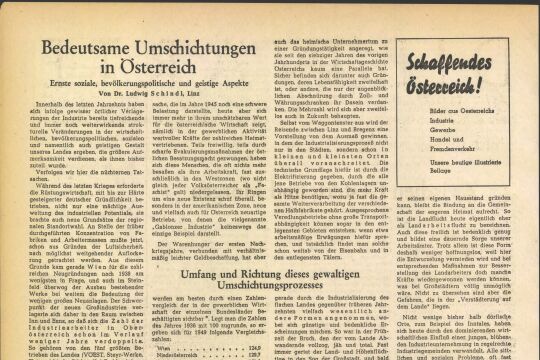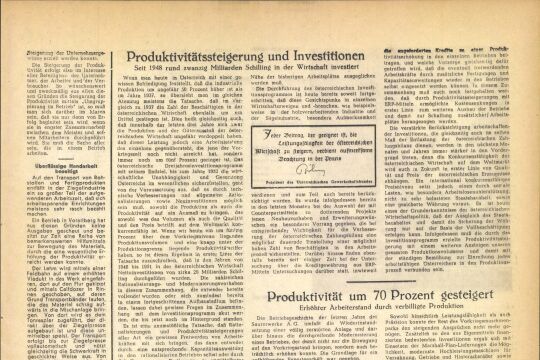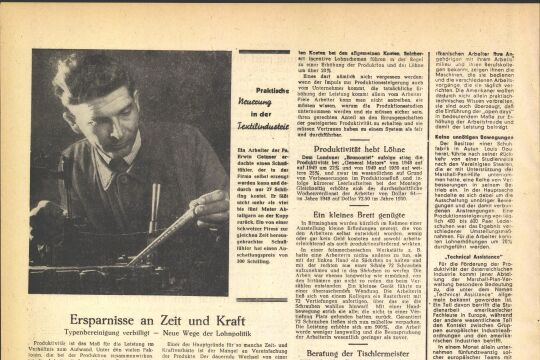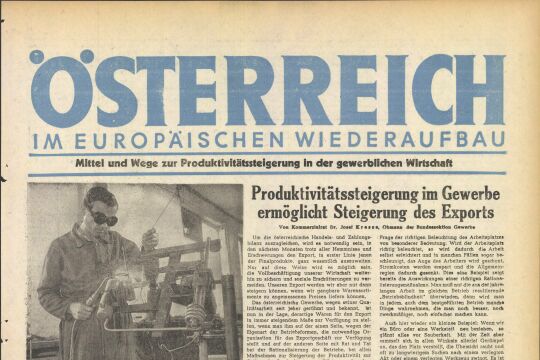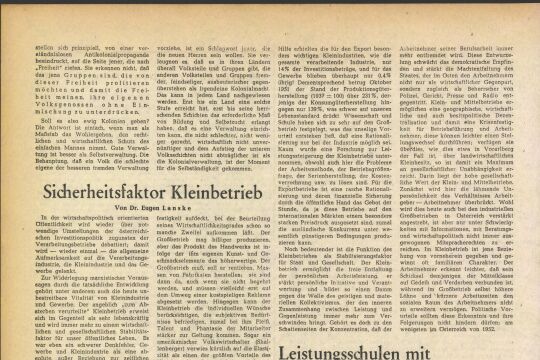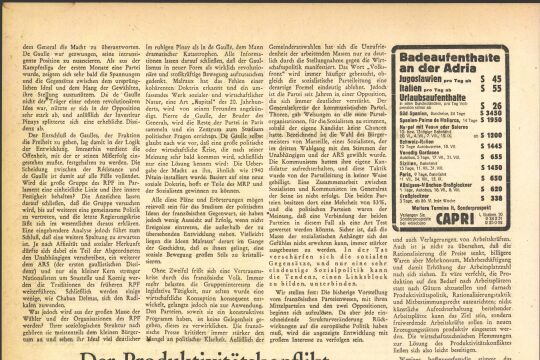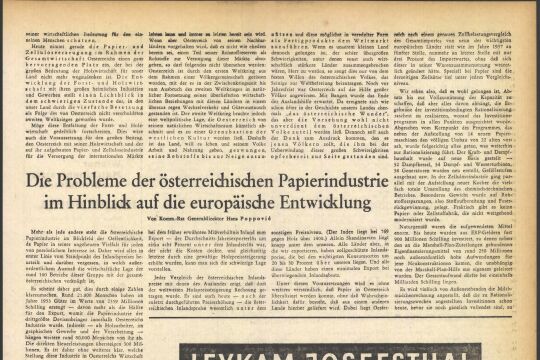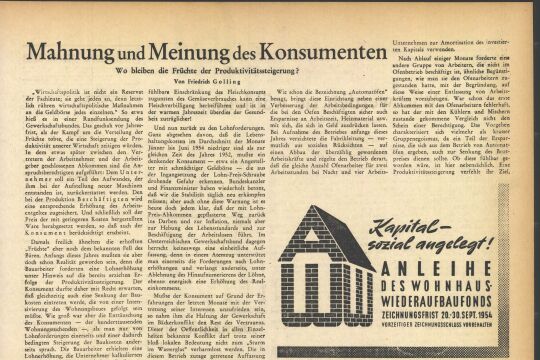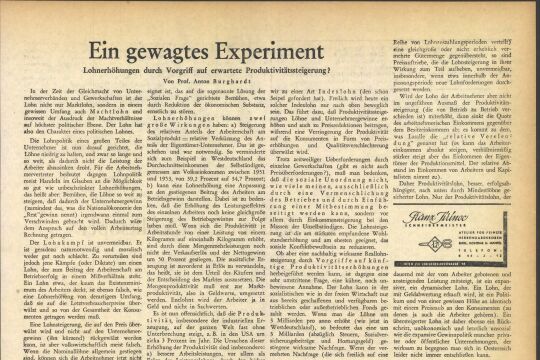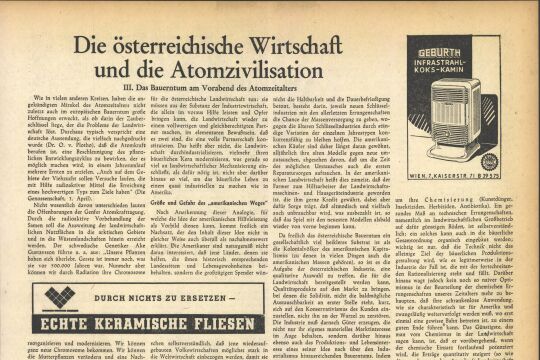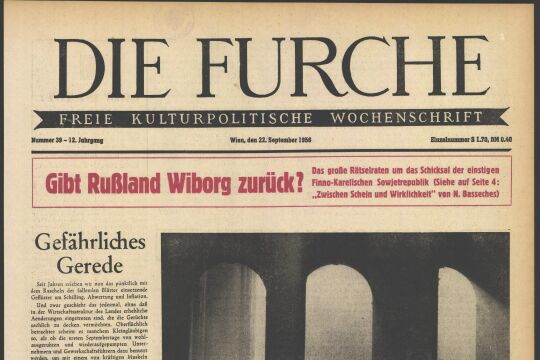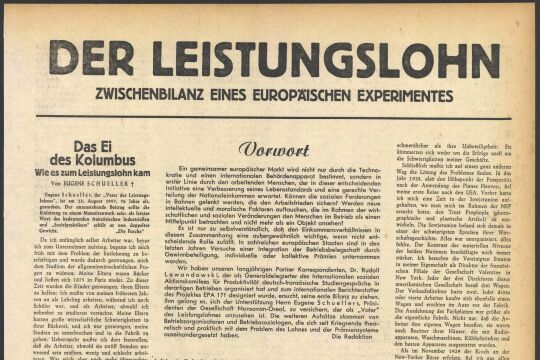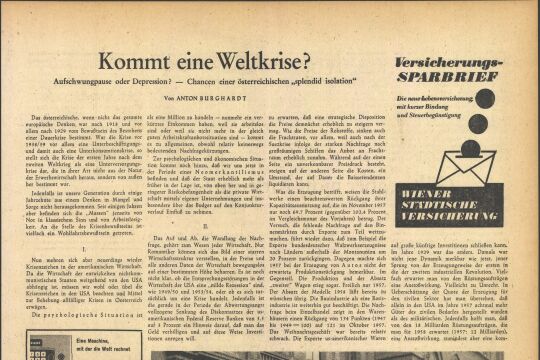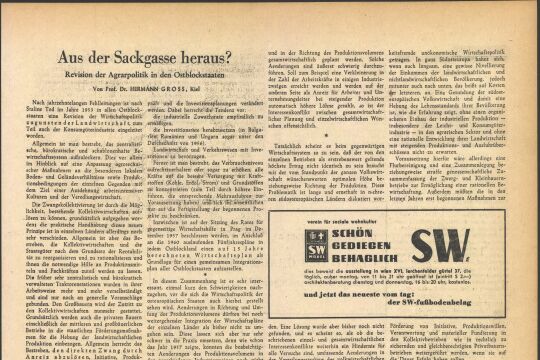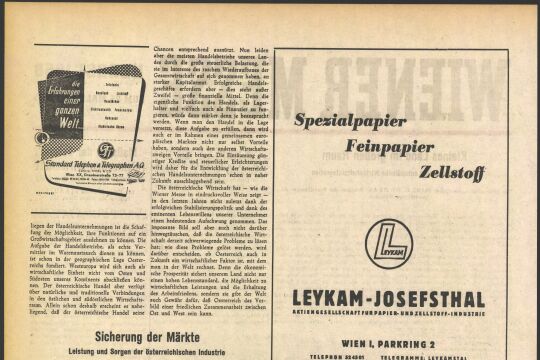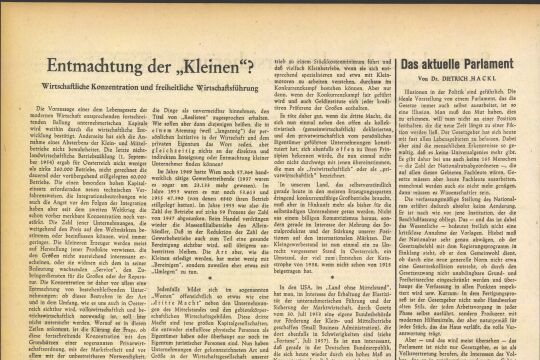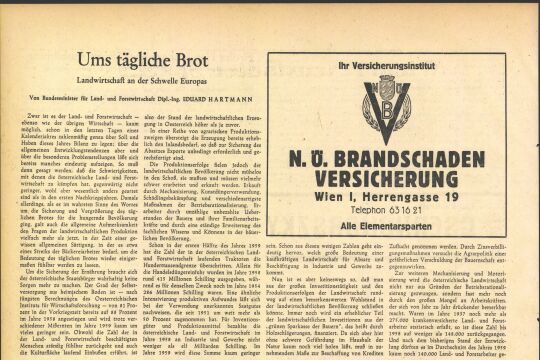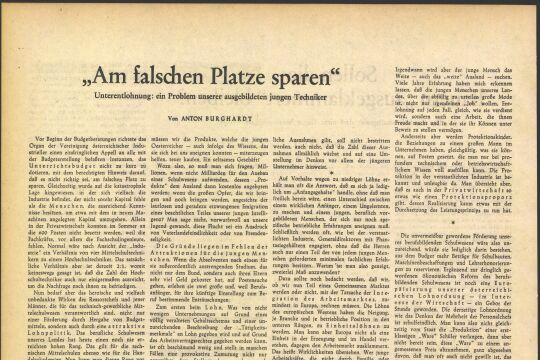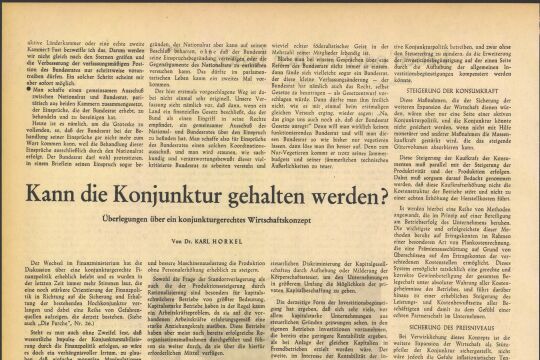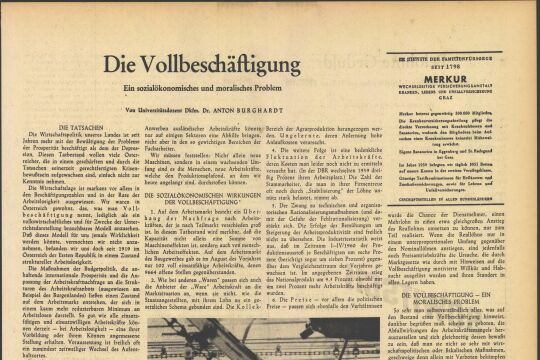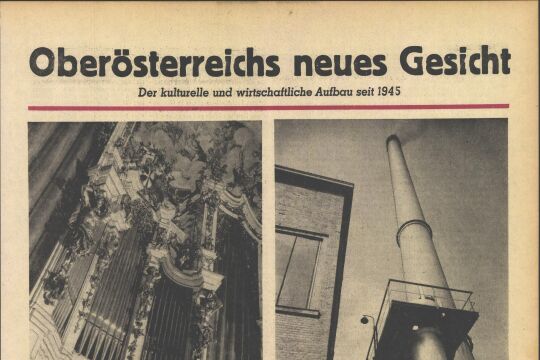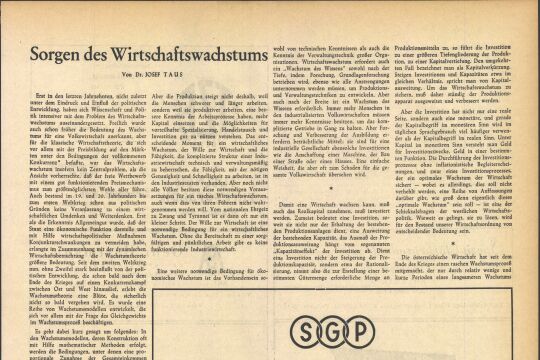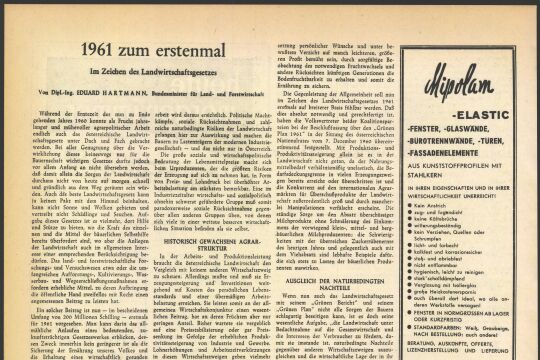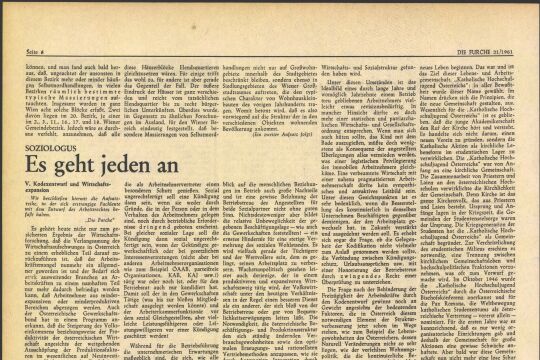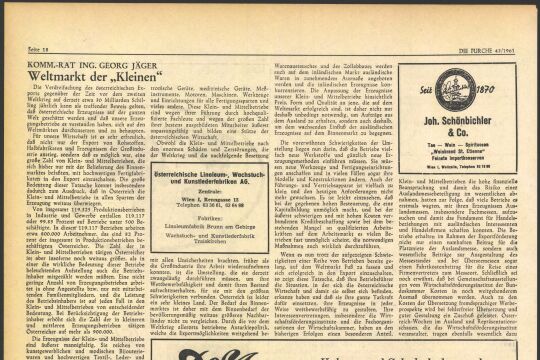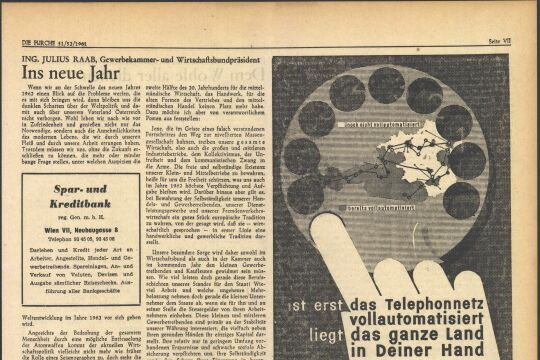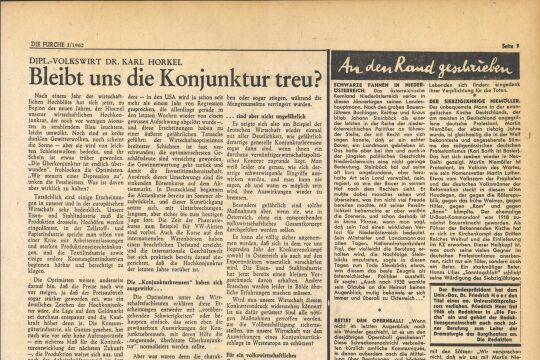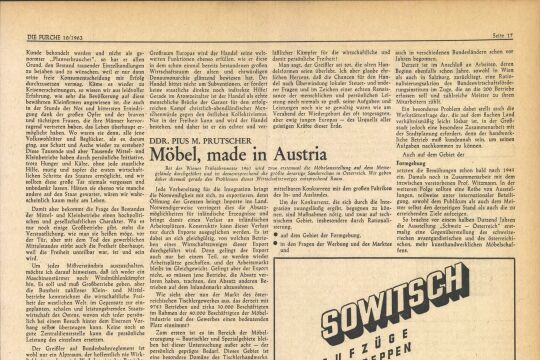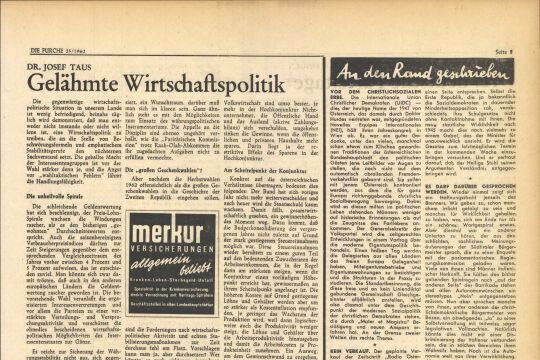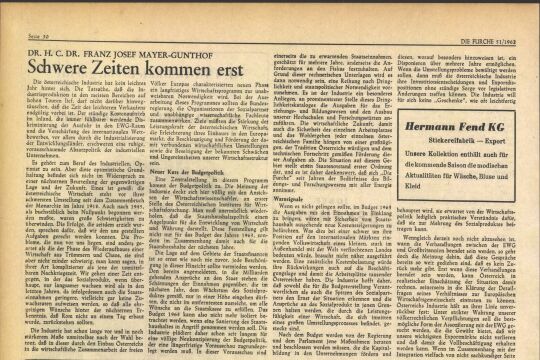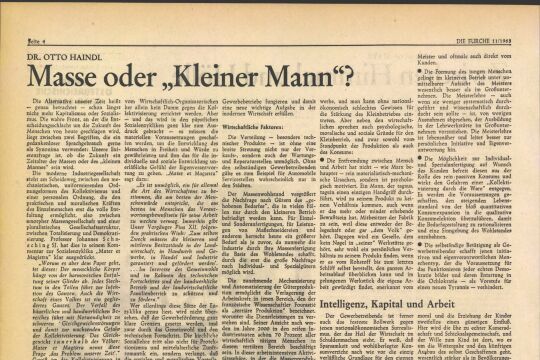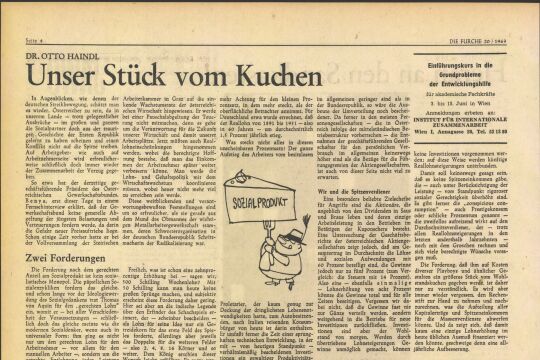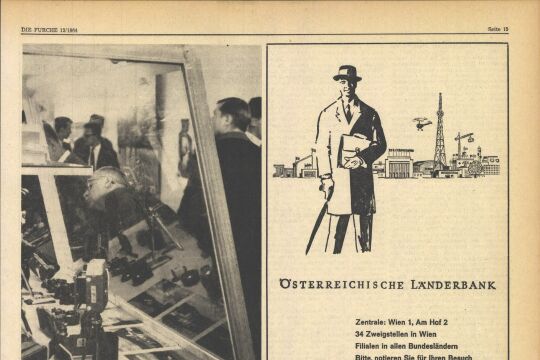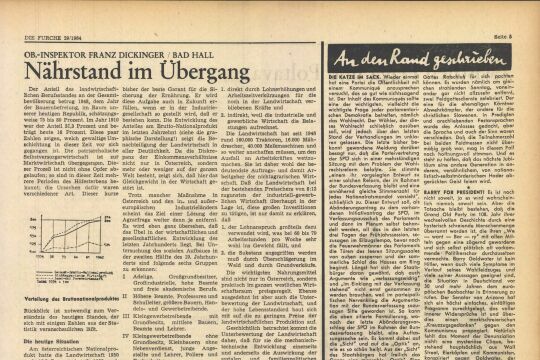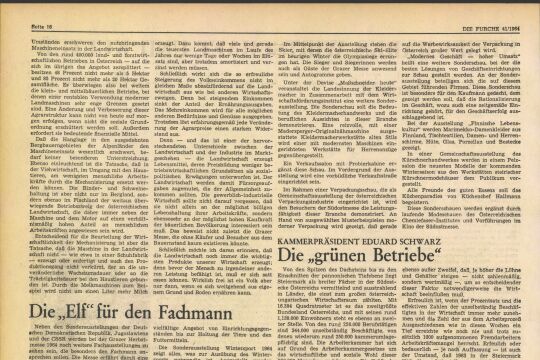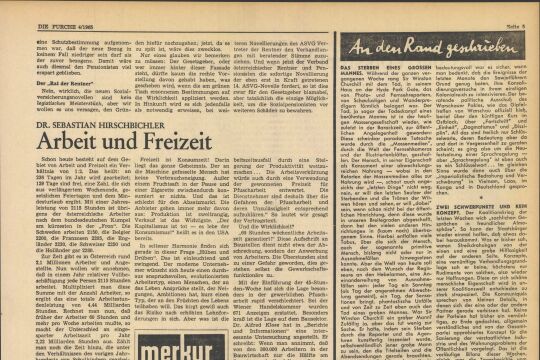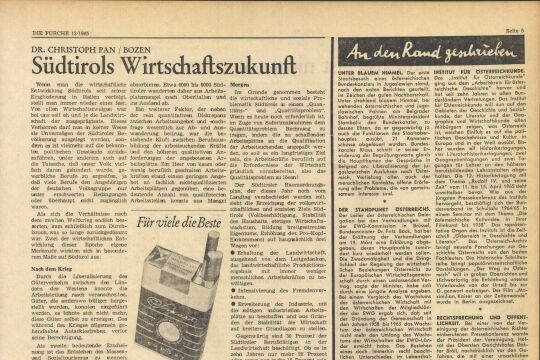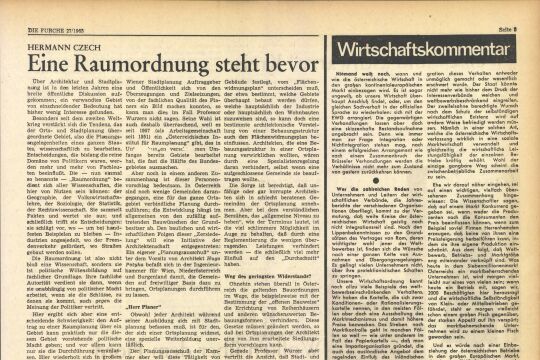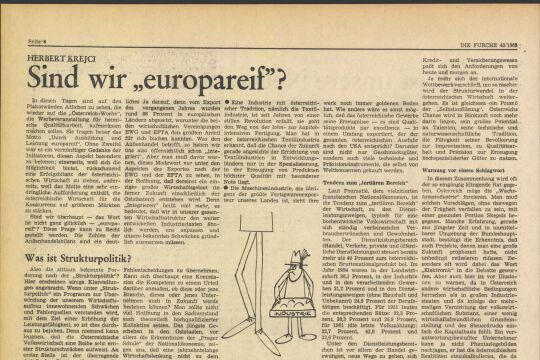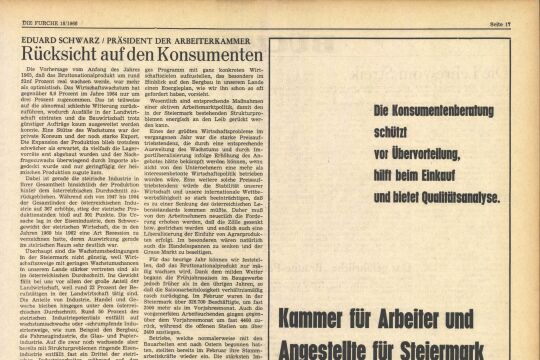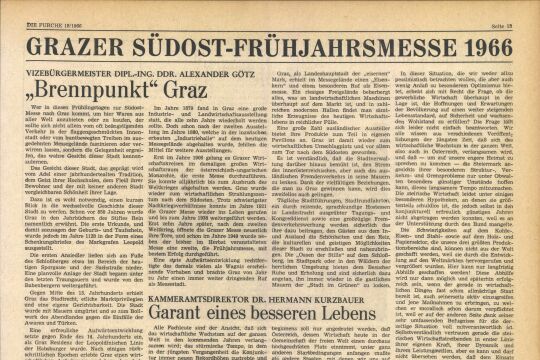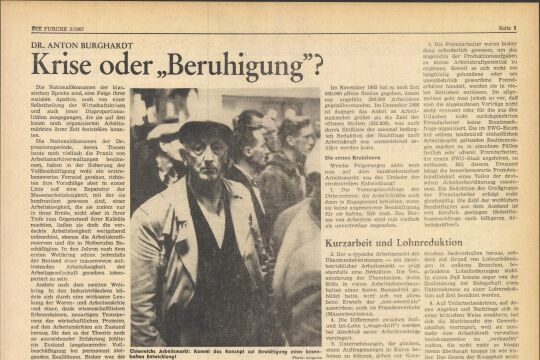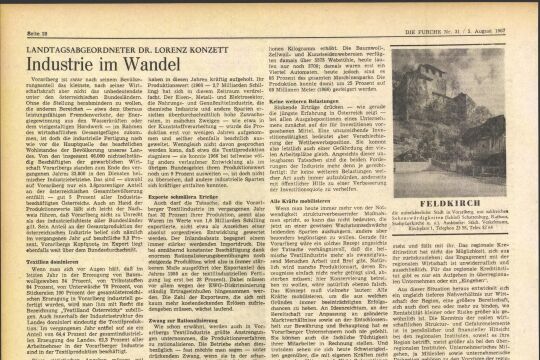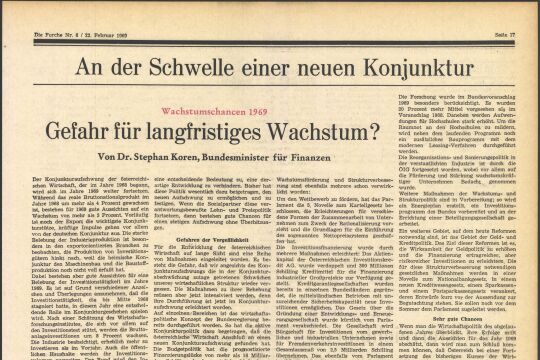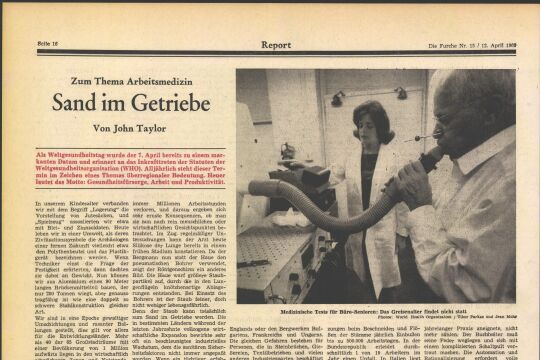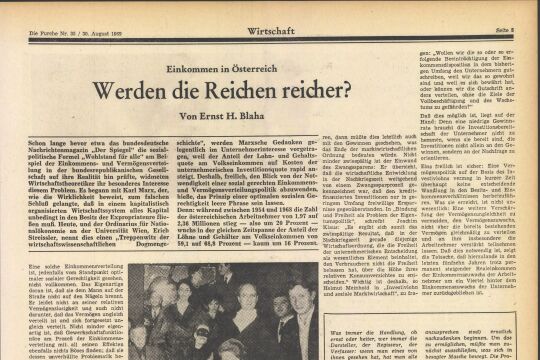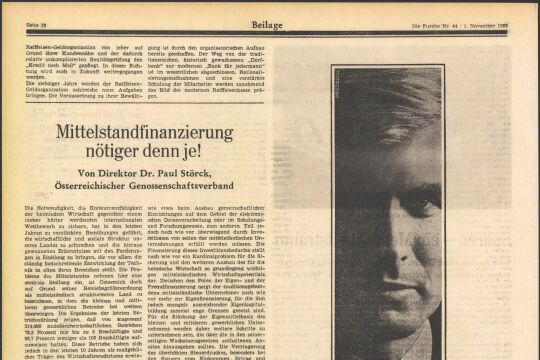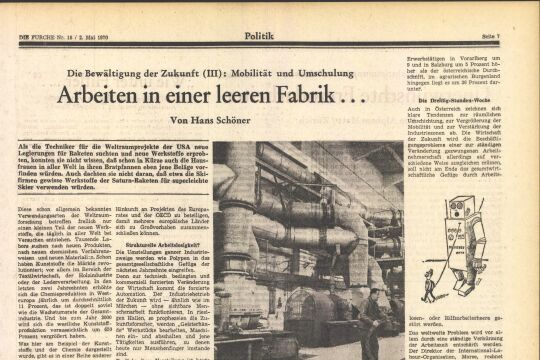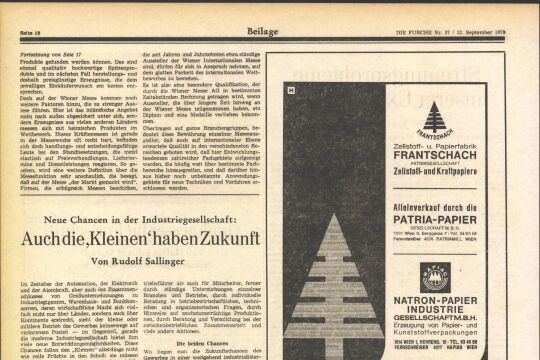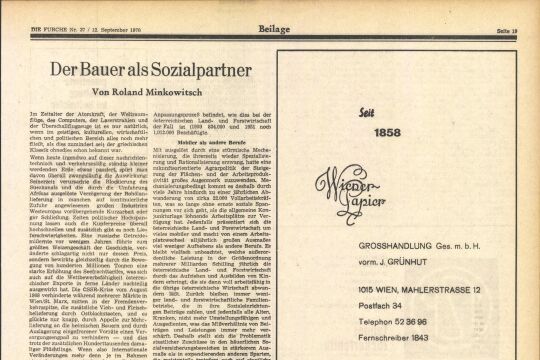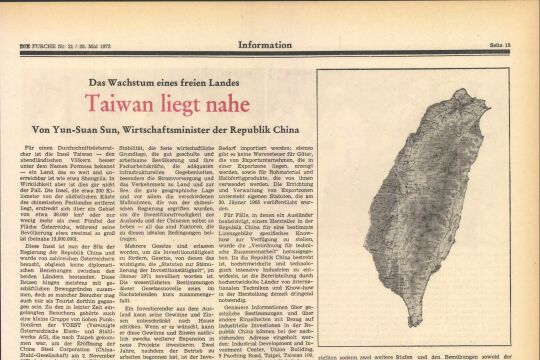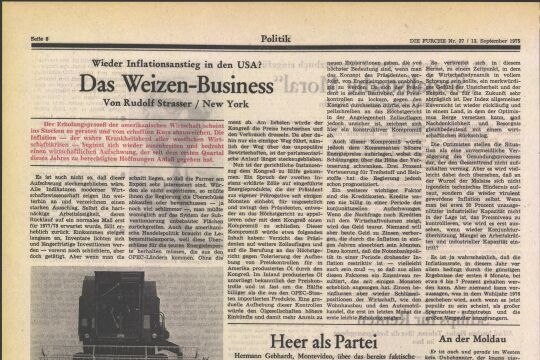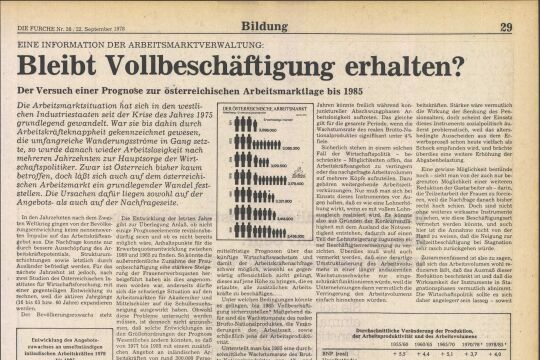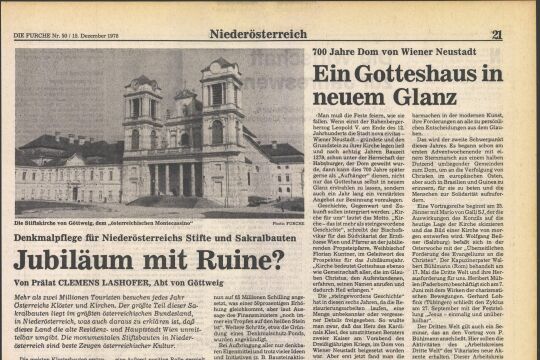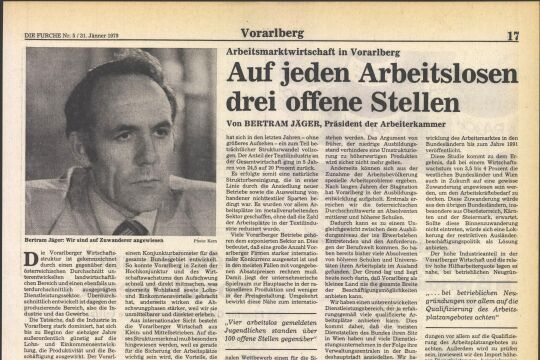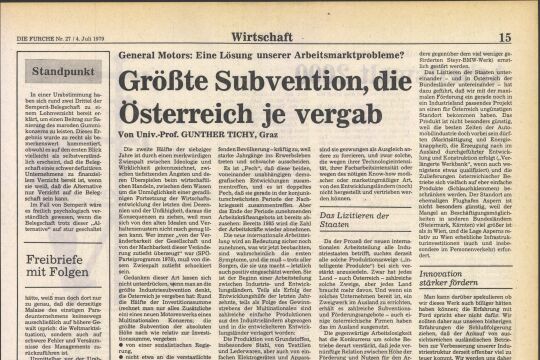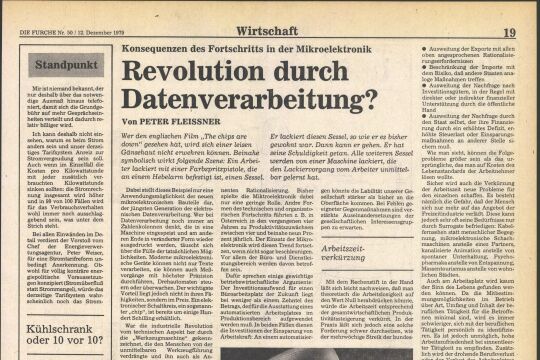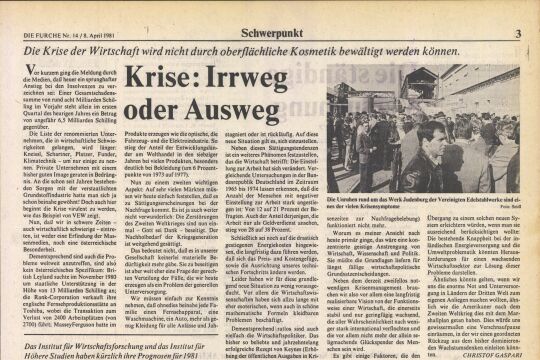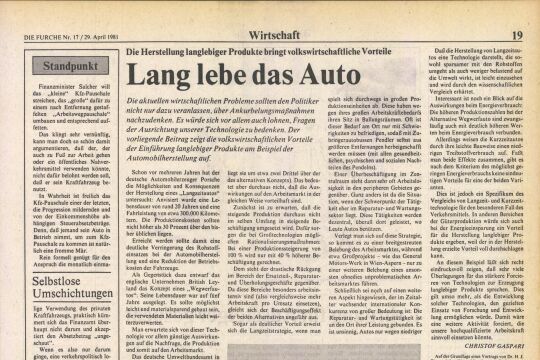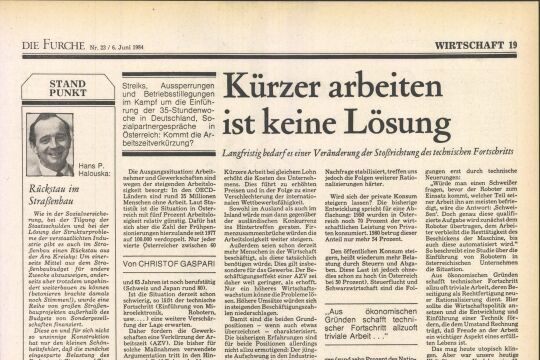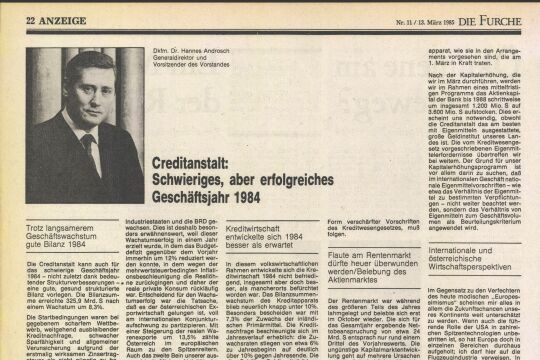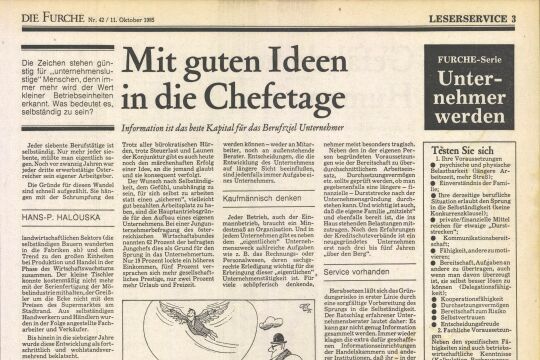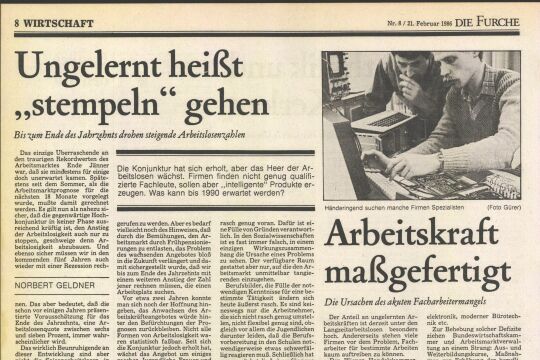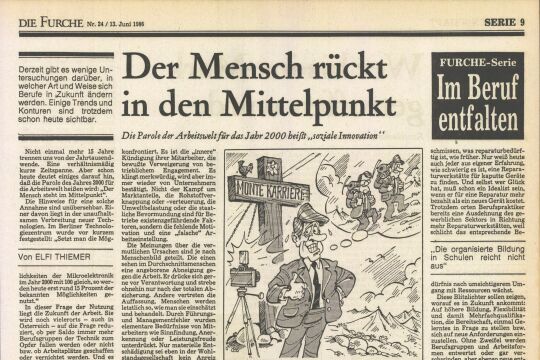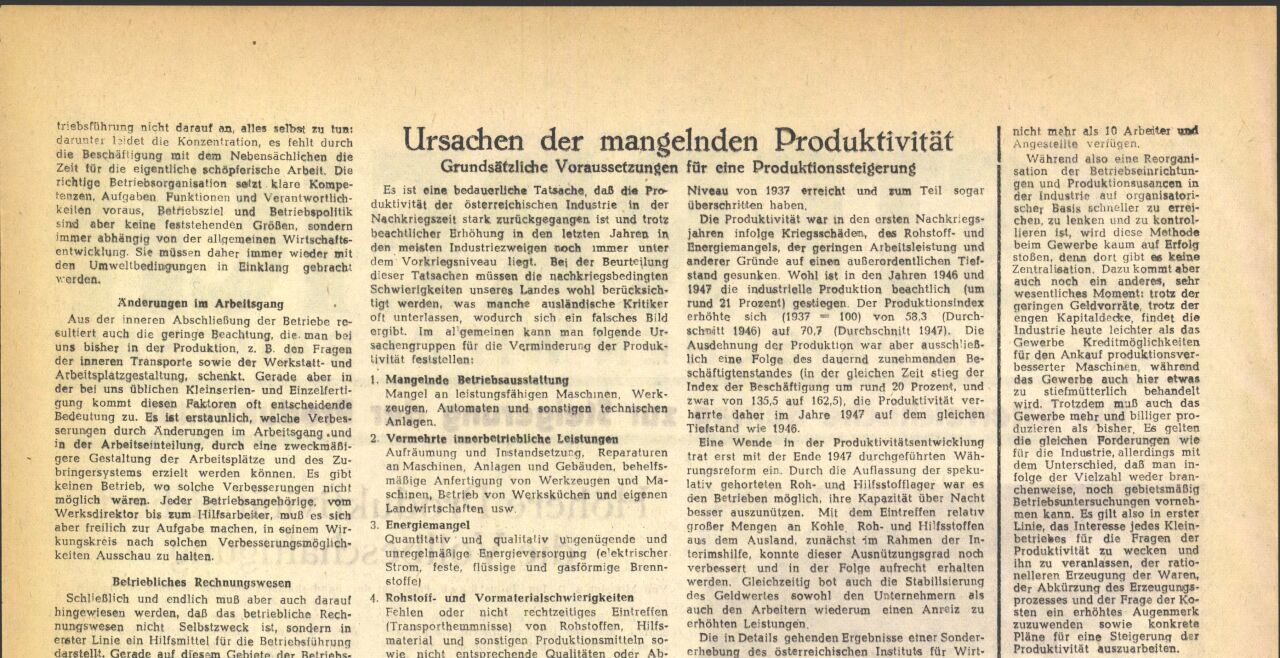
Es ist eine bedauerliehe Tatsache, daß die Produktivität der österreichischen Industrie In der Nachkriegszeit stark zurückgegangen ist und trotz beachtlicher Erhöhung in den letzten Jahren in den meisten Industriezweigen noch immer unter dem Vorkriegsniveau liegt. Bei der Beurteilung dieser Tatsachen müssen die nachkriegsbedingten Schwierigkeiten unseres Landes wohl berücksichtigt werden, was manche ausländische Kritiker oft unterlassen, wodurch sich ein falsches Bild ergibt. Im al'gemeinen kann man folgende Ursachengruppen für die Verminderung der Produktivität feststellen:
1. Mangelnde BeUiebsausstattung
Mangel an leistungsfähigen Maschinen, Werkzeugen, Automaten und sonstigen technischen Anlagen.
2 Vermehrte innerbetriebliche Leistungen
Aufräumung und Instandsetzung, Reparaturen an Maschinen, Anlagen und Gebäuden, behelfsmäßige Anfertigung von Werkzeugen und Maschinen, Betrieb von Werksküchen und eigenen Landwirtschaften usw.
3. Energiemangel
Quantitativ und qualitativ ungenügende und unregelmäßige Energieversorgung (e'ektrischer Strom, feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe)
4. Rohstoff- und Vormaterialschwierigkeiten
Fehlen oder nicht rechtzeitiges Eintreffen (Transporthemmnisse) von Rohstoffen, Hilfsmaterial und sonstigen Produktionsmitteln sowie nicht entsprechende Qualitäten oder Abmessungen.
5. Mangel an Facharbeitern
6. Ausfall von Arbeftsze't
7. Effektiv gesunkene Arbeitsleistung
infolge unzureichender Ernährung, Beheizung, Be'euchtung usw., geringerer Arbeitsfreude (Mangel an Konsumgütern, psychische Beeinflussung).
Nach einer Erhebung des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung betrug im Jahre 1947 die Produktivität in 91 Industriebetrieben mit rund 33.000 Arbeiten) durchschnittlich 56 Prozent, stieg im Jahre 1948 auf rund 75 Prozent, 1949 auf 80 Prozent und 1950 auf rund 85 Prozent.
Im heurigen Jahr konnte die Produktivität bei einer Reihe von Betrieben weiter gesteigert werden, so daß manche Betriebe bereits wieder das
Niveau von 1937 weicht und rum Teil sogar überschritten haben,
Die Produktivität war in den ersten Nachkriegs-jahren infolge Kriegsschäden„ des Rohstoff- und Energiemangels, der geringen Arbeitsleistung und anderer Gründe auf einen außerordentlichen Tiefstand gesunken. Wohl ist in den Jahren 1946 und 1947 die industrielle Produktion beachtlich (um rund 21 Prozent) gestiegen. Der Produktionsindex erhöhte sich (1937 = 100) von 58,3 (Durch-chTOtt 1946) auf 70,7 (Durchschnitt 1947). Die Ausdehnung der Produktion war aber ausschließlich eine Folge des dauernd zunehmenden Beschäftigtenstandes (in der gleichen Zeit stieg der Index der Beschäftigung um rund 20 Prozent, und zwar von 135,5 auf 162,5), die Produktivität verharrte dahor im Jahre 1947 auf dem gleichen Tiefstand wie 1946.
Eine Wende in der Produktivitätsentwicklung trat erst mit der Ende 1947 durchgeführten Währungsreform ein. Durch die Auflassung der spekulativ gehorteten Roh- und Hilfsstofflager war es den Betrieben möglich, ihre Kapazität über Nacht besser auszunützen. Mit dem Eintreffen relativ großer Mengen an Kohle Roh- und Hilfsstoffen aus dem Ausland, zunächst -im Rahmen der In-torimshilfe, konnte dieser Ausnutzungsgrad noch verbessert und in der Folge aufrecht erhalten werden. Gleichzeitig bot auch die Stabilisierung des Geldwertes sowohl den Unternehmern als auch den Arbeitern wiederum einen Anreiz zu erhöhten Leistungen.
Die in Details gehenden Ergebnisse einer Sondererhebung des österreichischen Institute für Wirtschaftsforschung illustrieren diese Entwicklung:
Der Mangel an Energie, der im Jahre 1947 noch zu 6 Prozent am Rückgang der Produktivität (Gesamtrückgang 44 Prozent gegenüber 1937) beteiligt war, spielt im ersten Halbjahr 1948 (rund 30 Prozent gegenüber 1937) nur noch mit 3 Prozent eine Rolle. Gleichzeitig ging der Anteil der Rohstoffschwierigkeiten von 9 Prozent auf 7 Prozent zurück. Auch, die übrigen produktivitäts-mindernden Gründe verloren in den folgenden Jahren an Bedeutung.
Jede weitere Steigerung der Produktivität aber ist von der Erfüllung zweier grundsätzlicher Forderungen abhängig:
Erstens muß sich die Wirtschaftspolitik sowohl in ihren Grundsätzen als auch in ihren Einzelmaßnahmen vom Gedanken eines gesunden Leislungswettbewerbes leiten lassen, das heißt, sie muß dem schaffenden Menschen, dem Unternehmer so gut wie dem Ar-heiter, Angestellten und frei Schaffenden wieder zu dem Bewußtsein verhelfen, daß es sich lohnt, sich durch Leitung ein höheres Einkommen zu erarbeiten.
Als wichtigste Voraussetzung hiefür erweist sich eine lebensnahe, sich ständig modifizierende Synthese zwischen dem marktwirtschaftlichen Selek-üornsprinzip und einer wohlbedachten staatlichen Einflußnahme. Durch sie muß es der Wirtschaftspolitik möglich sein, die Initiative des einzelnen und sein Streben nach persönlichem Erfolg zum Vorteil der Gesamtwirtschaft zu lenken.
Im einzelnen hängt die Steigerung der Produktivität vor allem von stabilen Währ-rngsverhält-nissen, von einem gesunden Staatshaushalt, einer produktionsfreundlichen Steuerpolitik, einer bewußt leistungsfördernden Lohnpolitik wnd einer Handelspolitik ab, die Österreich ans seiner Marktenge herausführt und wieder in den weltwirtschaftliehen Zusammenhang einordnet. Konform damit sollte sich die österreichische Wirtschaftspolitik auch auf allen übrigen Gebieten von dem herrschenden Geist der Restriktion abwenden, Nicht zuletzt aber bedarf die österreichische Wirtschaft, vor allem die vielfach unter technischer Rückständigkeit leidende österreichische Industrio, der Erneuerung ihres Pro-duktionsapparates. Daneben dürfen aber auch die produktivitätssteigernden Möglichkeiten einer zielbewußten Rationalisierung der Betriebsorganisation nicht übersehen werden.
Zweitens ist es notwendig, daß sich das ganze Volk der Größe und der Dringlichkeit dieser Aufgaben voll bewußt wird. Die Wirtschafts-polit'k muß die Steigerung der Produktivität zu einer wirklichen „res publica“ erheben. Unternehmer, Arbeiter und Angeste'lte werden sich nur dann zu einer großen nationalen Kraftanstrengung vereinen, wenn s!e wessen, wofür sie arbeiten, wenn sie die Ziele und die Probleme der Wirtschaft kennen und daher an ihrer Lösung bewußt mitzuarbeiten, gegebenenfalls sich aber auch kritisch zu äußern vermögen.
Wie die Moral im Betriebe dort am besten ist, wo die Leitung der Belegschaft ständig Sinn und Zweck ihrer Anstrengungen erklärt und sie laufend über die Betriebsergebnisse intormiert, so kann auch die Gesamtwirtschaft nur gedeihen, wenn zwischen der wirtschaftspolitischen Spitze und den Trägern der Wirtschaft ein Vertrauensverhältnis besteht. Erst das Bewußtsein, Mitarbeiter und Mitgestalter an einem größeren Werke zu sein, macht die besten Kräfte in den Menschen frei und befähigt sie zu höheren Leistungen. Dieses Erlebnis wird nicht zu'etzt durch eine gewissenhafte, mutige, auch unpopuläre Wahrheiten nicht verschweigende Aufklärung aller Schichten des Volkes über die unabdingbaren Beziehungen zwischen Produktivität und Lebensstandard sowie über den engen Zusammenhang zwischen Produktivität und sozialem Fortschritt geformt.
nicht mehr als 10 Arbeiter ad Angestellte verfügen.
Während also eine Reorganisation der Betriebseinrichtungen und Produktionsusancen in der Industrie aut organisatorischer Basis schneller zu erreichen, zu lenken und zu kontrollieren ist, wird diese Methode beim Gewerbe kaum auf Erfolg stoßen, denn dort gibt es keine Zentralisation. Dazu kommt aber auch noch ein anderes, sehr wesentliches Moment: trotz der geringen Geldvorräte, trotz der engen Kapitaldecke, findet die Industrie heute leichter als das Gewerbe Kreditmöglichkeiten für den Ankauf produktionsver-besserter Maschinen, während das Gewerbe auch hier etwas zu stiefmütterlich behandelt wird. Trotzdem muß auch das Gewerbe mehr und billiger produzieren als bisher. Es gelten die gleichen Forderungen wie für die Industrie, allerdings mit dem Unterschied, daß man infolge der Vielzahl weder branchenweise, noch gebietsmäßig Betriebsuntersuchungen vornehmen kann. Es gilt also in erster Linie, das Interesse jedes Kleinbetriebes für die Fragen der Produktivität zu wecken und ihn zu veranlassen, der rationelleren Erzeugung der Waren, der Abkürzung des Erzeugurugs-prozesses und der Frage der Kosten ein erhöhtes Augenmerk zuzuwenden sowie konkrete Pläne für eine Steigerung der Produktivität auszuarbeiten.
Für den Kleinbetrieb hat vor allem die „Umgruppierung im Betrieb“ besondere Bedeutung. Man versteht darunter verschiedene Maßnahmen, meist organisatorischer Art, die Kraft und Zeit sparen. Bei ihr werden keine neuen modernen Maschinen eingestellt und es bedarf für sie keines großen Geldaufwandes. Es ist erstaunlich, welche Erfolge oft durch eine Abänderung im Arbeitsgang oder durch eine Verkürzung der Transportwege innerhalb des Betriebes selbst erzielt werden können. Auch im Kleinbetrieb muß der Arbeiter nur zu oft an jedem Tag mehrmals den weiten Weg ins Magazin machen, um Arbeitsmaterial/ herbeizuschaffen. Aber auch Werkstück und Werkzeuge liegen oft wirrverstreut in der Werkstatt herum. Wenn sie immer griffbereit sind, so bedeutet dies schon einen Beitrag zur Steigerung der Produktivität. Durch entsprechende Vorrichtungen kann das Bücken bei der Arbeit oder gar das Arbeiten in gebückter Stellung vermieden werden, der Arbeitstisch muß in richtiger Höhe sein, sitzen ermüdet weniger als stehen, und die Beleuchtung des Arbeitsraumes wie des Arbeitsplatzes wirkt sich ebenfalls auf die Arbeitsleistung aus, Alle diese Maßnahmen können meist auch im Kleinbetrieb ohne große Kosten durchgeführt werden, sie erleichtern die Arbeit und erhöhen die Produktivität, senken die Erzeugungskosten und machen auch den Gewerbebetrieb wieder konkurrenzfähig.
Die Umgruppierung im Betrieb“ wird im Ausland mit großem Erfolg im Interesse der Steigerung der Produktivität angewendet. Sie hat den großen Vorteil, daß sie ohne nennenswerte finanzielle Ausgaben in jeden Betrieb sofort begonnen werden kann. Hier sind einige Ergebnisse der „Umgruppierung im Betrieb“ von englischen Unternehmungen;
Es handelt sich dabei um die verschiedenartigsten Betriebe, sowohl was die Größe als auch was die Art der hergestellten Waren betrifft. Auch das Ausmaß der Zunahme der Produktivität und der Zeitraum, innerhalb dessen sie erreicht wurde, sind sehr verschieden. Aber wie groß die Unterschiade auch sein mögen, in allen Betrieben hat die Steigerung der Produktivität es möglich gemacht, die Produktionskosten zu senken und die Löhne zu erhöhen.
Das Unternehmen wird daher instand gesetzt, seine Erzeugnisse billiger zu verkaufen und gleichzeitig seine Arbeiter besser zu entlohnen. Obwohl darüber nichts berichtet wird, kann doch angenommen werden, daß außer Preisermäßigung und Lohnerhöhung auch noch eine